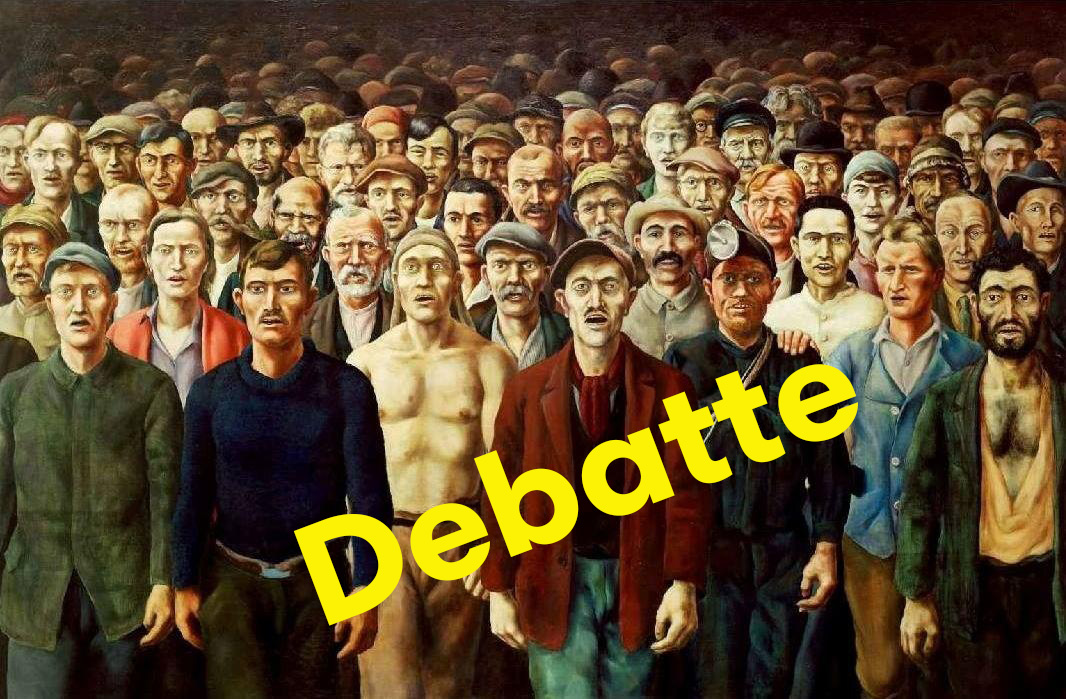Motiv: Geschichtswerkstatt des DGB Herne
Am 11. Janaur haben wir an dieser Stelle einen Artikel von Raul Zelik veröffentlicht. Sein Titel „Keine Illusionen über Venezuelas Regierung“ (https://gewerkschaftliche-linke-berlin.de/63430-2/) In diesem Artikel geht es dem Autor darum, zu begründen, warum die politische Verfasstheit der Maduro-Regierung einen erfolreichen Kampf gegen die Aggression des US-Imprialismus erschwert. Sie hat den akzeptierten Meinungskorridor und den Raum für die Wahrnehmung von Bürgerrechten eingeschränkt und geht teils drakonisch gegen die Opposition vor. Beileibe nicht nur gegen die putschistische Rechte sondern auch gegen die Linke. So wurde z.B. die KP nicht mehr zu den Wahlen zugelassen. Die Postchavisten haben einen Großteil ihrer Unterstützung in der Bevölkerung verloren. Am Schluss dieses Artikels zog der nd-Autor daraus eine strategische Schlussfolgerung. Zelik schrieb: „Wieder einmal zeigt sich, dass die »Verteidigung der nationalen Souveränität« zur Durchsetzung sozialer Rechte in Zeiten eines alles dominierenden kapitalistischen Weltmarkts kein geeignetes Mittel mehr ist.“ Dies führt im Anschluss zu heftigen Diskussionen innerhalb der Redaktion. Benedikt aus der Forumsredaktion formulierte seine Kritik daran in einem eigenen Artikel: sein Credo: „Ohne nationale Souveränität geht es nicht.“ (https://gewerkschaftliche-linke-berlin.de/ohne-nationale-souveraenitaet-geht-es-nicht/)
In dieser Aussage war sich die Redaktion einig. Ich habe mich daraufhin erneut an Raul gewandt mit der Bitte seine Position in einem weiteren Beitrag etwas ausführlicher zu begründen. Dieses Anliegen wurde in der nd-Redaktion diskutiert und als Ergebnios haben wir nun zwei weitere Artikel bekommen, die auch über die folgenden Links zu lesen sind. Pablo Flock votierte für „Staatensouveränität verteidigen“ und Raul Zelik ergänzte Flocks Ausführungen mit dem Artikel „Grönland den Eisbären“. Dabei will er diesen Artikel nicht als Widerspruch zu Flocks Artikel verstehen sondern den Horizont der Debatte ausweiten.
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1197054.voelkerrecht-staatensouveraenitaet-verteidigen.html?sstr=Flock
Zustimmend bezugnehmend auf die indisch-kanadische Soziologin Nandita Sharma schreibt Raul Zelik: „Wer meine, dass sich mit der Stärkung nationaler Souveränität soziale Rechte durchsetzen ließen, habe nicht verstanden, »was es mit der Ordnung der Nationalstaaten auf sich hat«. Statt für Staaten zu kämpfen, die dann – hoffentlich – eine ökologischere oder sozialere Politik machen, sollte man besser gleich Bewegungen aufbauen, die grenzüberschreitend für diese Ziele kämpfen.“
Ich denke, dass es hier nicht um ein Entweder/Oder geht, sondern dass beide Zielsetzungen zwar konfliktbeladen sind, jedoch unverzichtbar sind. Die Überwindung der ernüchternden politischen Bilanz der sozialrevolutionären Bewegungen, die Raul Zelik zu Recht zieht, lassen sich nicht einfach dadurch überwinden, in dem man das Kampffeld der nationalen Staatlichkeit ignoriert oder verlässt. Denn nach bald 200 Jahren Geschichte der modernen Arbeiterbewegung gibt es wenig begründeten Anlass anzunehmen, sie könnte sozusagen in einem Ruck auf der internationalen Ebene die Nationalstaaten begraben und den Kommunismus realisieren. Bereits im Kommunistischen Manifest schrieben Marx/Engels: „Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form nach der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler. Das Proletariat eines jeden Landes muß natürlich zuerst mit seiner eigenen Bourgeoisie fertig werden“ (MEW 4, 473). Das Kampffeld des Nationalstaats bleibt auch weiterhin der Hebel der Selbstermächtigung, denn hier liegt der entscheidende Rechtsrahmen, der politisch und kulturell die Klassenkämpfe strukturiert. Und es ist von Vorteil, wenn dieses Kampffeld nicht noch durch Herrschaftsansprüche anderer imperialer Mächte besetzt wird, was natürlich besonders bei neokolonioalen Abhängigkeitsverhältnissen wie im Beispiel Venezuelas eine Rolle spielt. Natürlich kann man nicht der Politik einer herrschenden Klasse folgen, die im Namen der „nationalen Souveränität“ gerade auf die Machtausweitung und Einschränkung der Souveränität anderer Staaten abzielt wie das beim EU-Diskurses zur Frage der nationalen Souveränität offensichtlich der Fall ist.
Das eigentliche Problem ist eher die mangelnde internationalistische Einbettung dieser Kämpfe, die unverzichtbar ist, das gemeine Klasseninteresse zu definieren und es in der Standortkonurrenz und in Zeiten kriegerischer Aufhetzung zu verteidigen. Die Arbeiterinternationalen I-IV waren ja – trotz Misserfolgen und Scheitern – bedeutende Anläufe, eine solche gemeinsame Orientierung zu ermöglichen. Die Wiederaufnahme dieser Anstrengungen scheint mir auch heute recht alternativlos. Hier sollten sich alle organisieren, für die gemeinsame Klasseninteresse und keine nationalen Identitäten entscheidend sind. Der Kern eines solchen Ankers könnte aus den realen Kämpfen hervorgehen. Gleichzeitig müssen unterschiedliche politische Zugänge ermöglicht und verteidigt werden. Das Praxisfeld dürfte sich dann in der Bandbreite bewegen, die zwischen der Politik der nationalen Sektionen des Internationalen Gewerkschaftsbundes, die sich mehrheitlich national vereinnahmen lassen und politisch-ideologisch enger ausgerichten Basisnetzwerken liegen, die zwar internalistisch verlässlich sind, aber nur beschränkte Einflussmöglichkeiten haben. Vielleicht kann uns auch die „Kanonen statt Butter-Politik der herrschenden Klassen dabei behilflich sein, hier Fortschritte zu erzielen. Wie, das lässt sich z.B. sehr gut an der Politik der Partei der Arbeit Belgiens verfolgen.
Ein hoffnungsvoller Aufbruch in diese Richtung war ja auch die globalisierungskritische Bewegung der 90er und Nullerjahre dar, die jedoch letztlich auseinanderfiel und keine bleibende Struktur schaffen konnte. Die kommunikativen Voraussetzungen dafür sind angesichts der heute verfügbaren Übersetzungswerkzeuge besser denn je.