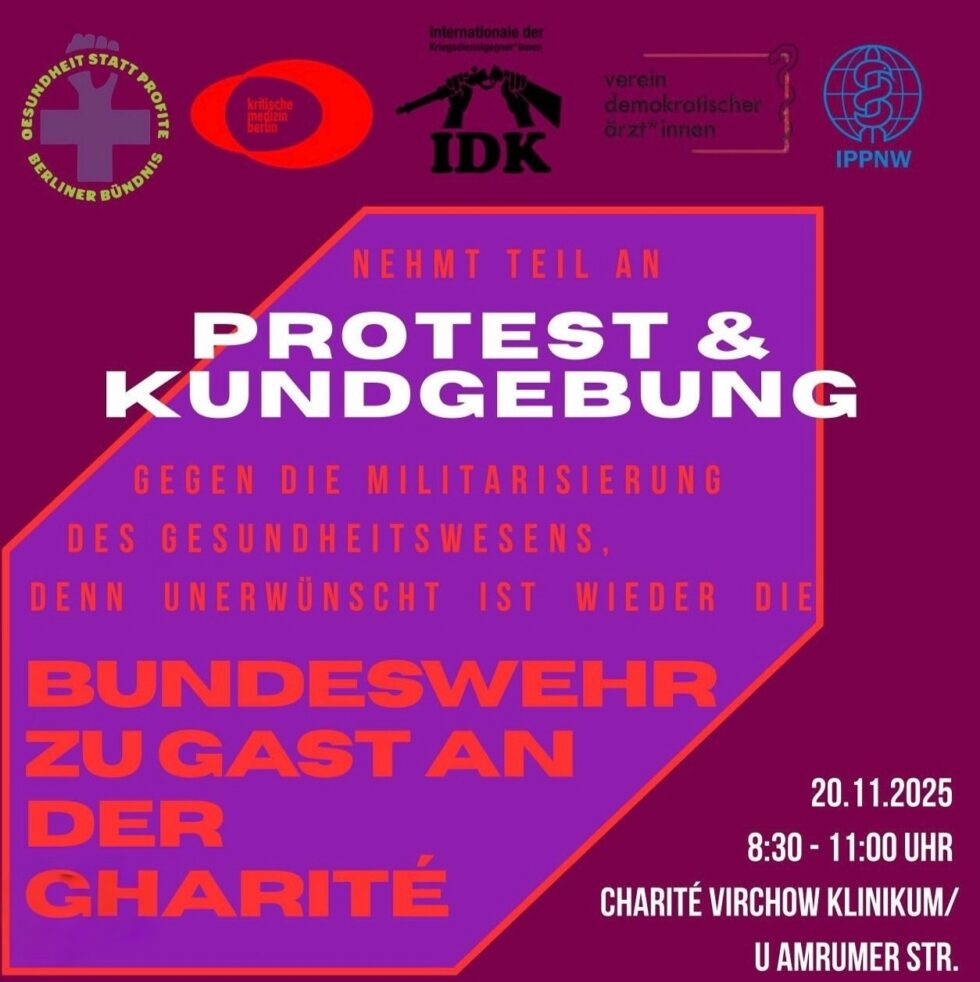Der Autor nimmt die ökonomischen Folgen der US-amerikanischen Zollpolitik unter die Lupe. Er geht davon aus, dass die Weltwirtschaft in Schwierigkeiten kommt, wenn bei ihrer steigenden Arbeitsproduktivität und erweiternden kapitalistischen Mehrwertproduktion eine entsprechende Ausdehnung des Marktes zur Realisierung des Mehrwertes ausbleibt.
Von Robert Schlosser
Bild: freepic
Wir leben zweifellos nicht im Jahr 1930, als der Smoot-Hawley Tariff Act in den USA in Kraft trat. Das Gesetz sollte durch Zölle auf tausende von Waren zusätzliche Einnahmen für die US-Regierung bringen und gleichzeitig Bauern sowie Industrien schützen. Stattdessen entwickelte sich ein Handelskrieg zwischen den kapitalistischen Ländern. Andere Staaten reagierten auf den Protektionismus der USA ebenfalls mit Zollerhöhungen. Der sich verallgemeinernde Protektionismus sorgte schließlich dafür, dass die schwere Wirtschaftskrise, die mit dem „Schwarzen Freitag“ von 1929 begann, sich in eine lang anhaltende und schwere Depression der Weltwirtschaft verwandelte. Alle ernst zu nehmenden Ökonom:innen und Ökonomiekritiker:innen sind sich darin einig, dass der Handelskrieg sich verheerend auf die erweiterte Reproduktion von Kapital („Wachstum“) auswirkte.1
Ein „revolutionärer Denker“ kommt jetzt zu ganz anderen Erkenntnissen. Unter dem Titel „Trump erklärt Handelskrieg und Zölle mit wirren Thesen“ heißt es in der Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau vom 3. April:
„So erklärte Trump, dass die USA die Große Depression mit Zöllen hätten vermeiden können. (…) Während seiner Rede deutete Trump an, dass der wirtschaftliche Abstieg der USA bereits 1913 begonnen habe, als die Einkommenssteuer eingeführt wurde. ‚Im Jahr 1913 wurde aus Gründen, die der Menschheit unbekannt sind, die Einkommenssteuer eingeführt, sodass nicht mehr ausländische Staaten, sondern die Bürger selbst das Geld für den Betrieb unserer Regierung zahlen mussten‘, so Trump. Weiterhin sagte er: ‚Dann, im Jahr 1929, fand das alles ein abruptes Ende mit der Großen Depression. Und das wäre niemals passiert, wenn sie bei der Zollpolitik geblieben wären.‘“
„Libertären“ Größen des Geistes wie Trump erscheint es ganz unerhört, wenn Einkommenssteuern für „den Betrieb der Regierung“ eines Landes erhoben werden. Zumindest für den Betrieb der US-amerikanischen Regierung sollen gefälligst „ausländische Staaten“ das nötige Geld zahlen. Was soll man auch von jemandem erwarten, der im Kampf gegen das Coronavirus Desinfektionsmittel spritzen lassen wollte? Es soll hier jedoch überhaupt nicht um die Blödheit gehen, mit der Reaktionäre wie Trump ihre Politik begründen2, sondern um die politische Praxis selbst und was sie für die kapitalistische Ökonomie und die darauf gegründete Gesellschaft bedeutet.
Hätten die USA und andere Staaten auf die 2008 sich verallgemeinernde Wirtschaftskrise mit einer Handelspolitik reagiert, wie Trump sie jetzt in die Tat umsetzt, dann wäre sie nicht so glimpflich abgelaufen. Man hätte dann vermutlich nicht nur „in den Abgrund geschaut“ (Peer Steinbrück), sondern wäre in ihn hinabgestürzt – ähnlich wie nach 1930. Damals funktionierte die unter Führung der USA nach dem Zweiten Weltkrieg installierte „kooperative Wirtschaftsordnung“ noch. Alle wichtigen kapitalistischen Länder reagierten auf gleiche oder ähnliche Weise, um die spontane Krisendynamik zu brechen und die drohende Depression zu verhindern oder zu verkürzen. Der ruinöse Kampf der „verfeindeten Brüder“ blieb aus.
Aus Sicht der marxschen Kapitalkritik verlangt die sich auf Basis steigender Arbeitsproduktivität erweiternde kapitalistische Mehrwertproduktion eine entsprechende Ausdehnung des Marktes zur Realisierung des Mehrwerts. Sind praktisch alle Länder in den kapitalistischen Weltmarkt integriert, nachdem Kolonialismus und Staatssozialismus Geschichte sind, so verlangt Ausdehnung des Weltmarktes vor allem Freihandel, eine Welt, in der das Kapital sich frei bewegen kann und vor allem die Höhe der Arbeitsproduktivität über Erfolg oder Misserfolg in der Konkurrenz entscheidet. Ein solcher Freihandel führt weder zu einer von Wirtschaftskrisen freien Entwicklung noch zu einer Aufhebung der enormen Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Länder, aber er ist notwendige Bedingung für das Wachstum des Kapitals im Allgemeinen oder für allgemeines, weltweites kapitalistisches Wachstum. Indem der Freihandel die Akkumulation von Kapital begünstigt, fördert er zugleich die Tendenzen zur Überakkumulation und damit zur Krise. Den sozialen Preis dafür zahlen primär Lohnarbeiter:innen und freigesetzte, zur Lohnabhängigkeit ohne Lohnarbeit verdammte Subsistenz- und kleine Warenproduzent:innen weltweit.
Länder, die die Industrialisierung nachholen, die Anschluss gewinnen wollen an die entwickeltesten kapitalistischen Länder, können jedoch auf Protektionismus, Schutz des nationalen Marktes nicht verzichten. Ihr Erfolg hängt wesentlich von ihrem Protektionismus und dem vorherrschenden Freihandel auf dem Weltmarkt ab. Diese Zusammenhänge lassen sich recht gut an den tatsächlichen ökonomischen Entwicklungen in der Welt ablesen.3
Die Situation heute ist wesentlich anders als 1930 und auch 2008. Trump reagiert mit seiner Zollpolitik nicht auf eine spontan einsetzende und sich rasch entwickelnde Wirtschaftskrise. Sein Protektionismus zielt vorwiegend darauf ab, den drohenden Verlust der US-Dominanz in der Weltwirtschaft zu verhindern. Was in der ökonomischen Konkurrenz immer weniger gelingt, soll nun durch Staatsintervention mit politischen Mitteln erzwungen werden. Die USA seien über Jahrzehnte von ihren Handelspartnern „geplündert, gebrandschatzt und vergewaltigt“(Trump) worden. Wie die USA dennoch seit Jahrzehnten ihre führende Position in der Weltwirtschaft ausbauen konnten, wird so zu einem großen Rätsel. Erst mit dem nicht zuletzt durch US-amerikanische Investitionen in Gang gesetzten Aufstieg Chinas zur zweitgrößten kapitalistischen Wirtschaftsmacht ist diese Dominanz in Gefahr. Der Protektionismus der USA richtet sich daher auch vor allem gegen China.
Wenn hier von den USA oder China die Rede ist, dann sollte nicht vergessen werden, dass es kapitalistische Unternehmen sind, die Waren produzieren und verkaufen. Nicht Staaten! Trump und seinesgleichen schwätzen immer nur von Staaten. Deren Regierungen setzen Rahmenbedingungen für den Handel, die sich entweder stärker am Freihandel oder am Protektionismus orientieren. Vom Freihandel profitieren am meisten die Einzelkapitale mit der höchsten Arbeitsproduktivität und besonders jene, die durch technologischen Vorsprung in Schlüsseltechnologien marktbeherrschend sind. Der Vorsprung in der Arbeitsproduktivität und technologischer Vorsprung in Schlüsseltechnologien waren lange Zeit der Garant für die Vorherrschaft der US-amerikanischen Wirtschaft. Diese Zeiten nähern sich dem Ende. Trump will alle Unternehmen, die nicht in den USA produzieren und in ihren Branchen dem US-Kapital in der Konkurrenz überlegen sind, „bestrafen“. Er will ihren ökonomischen Erfolg mit politischen Mitteln brechen. Dafür nimmt er eine Rezession in Kauf und erwartet von der Bevölkerung der USA, dass sie durchhält, bis das versprochene goldene Zeitalter anbricht. Wie nach dem Zweiten Weltkrieg? Trump ist nicht nur eine Knalltüte, sondern auch eine sehr gefährliche Knalltüte!
China ist im Bewusstsein seiner Stärke offensichtlich dazu bereit, mit gleicher Münze heimzuzahlen und Zölle in gleicher Höhe zu erheben. Sollte auch die EU als dritte große Wirtschaftsmacht der Welt sich zu einer ähnlichen Reaktion durchringen, dann braucht es nur noch etwas Zeit, bis die drastischen Zölle sich in ebenso drastischen Preiserhöhungen für Produktions- und Konsumtionsmittel niederschlagen. Ist es so weit, dann werden Waren in großem Umfang unverkäuflich und die Überproduktionskrise wird sich als Weltwirtschaftskrise entfalten. In Anbetracht der enormen Überakkumulation von Kapital in allen seinen Formen ist eine gigantische Entwertung und Vernichtung von Kapital dann nicht ausgeschlossen. Die sozialen Konsequenzen kann man sich kaum ausmalen.
Als Kommunist sehe ich das heute mit sehr gemischten Gefühlen. Seit dem Scheitern der europäischen Revolutionen von 1848/49 waren Marx und Engels überzeugt: „Eine neue Revolution ist nur möglich im Gefolge einer neuen Krise. Sie ist aber auch ebenso sicher wie diese.“4 Seit diese Sätze geschrieben wurden, hat es viele zyklische Krisen der Kapitalakkumulation gegeben. Nicht einmal die große Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre hatte eine Revolution zur Folge, wie sie Marx und Engels damals vorschwebte. Es existiert kein Automatismus, der eine kapitalistische Krise in eine beginnende soziale Revolution umschlagen lässt. Sicher erscheint aber auch, dass eine große soziale Revolution, die auf die ökonomische Befreiung von Lohnarbeit zielt, nur möglich wird auf Basis einer allgemeinen Weltwirtschaftskrise, die die Lebensverhältnisse der Masse der Lohnarbeiter:innen in allen entwickelten kapitalistischen Ländern grundlegend erschüttert. Ohne diese Voraussetzung kann es überhaupt nicht zu einer kommunistischen Revolution kommen.
Die bisherigen revolutionären Versuche von Lohnarbeiter:innen, den Kapitalismus zu überwinden und sich ökonomisch zu befreien (hauptsächlich die Pariser Kommune, die Russische Revolution und Revolutionen in Deutschland und Ungarn), entwickelten sich alle auf Basis eines gesellschaftlichen Zusammenbruchs, der allerdings jeweils Folge eines Krieges war. In diesen revolutionären Versuchen handelten Lohnarbeiter:innen als politisch selbstständige Klasse, mit einem mehr oder weniger entwickelten Klassenbewusstsein, von dem heute nicht mehr viel übrig geblieben ist. Ein radikales Bedürfnis nach ökonomischer Befreiung und allgemeiner sozialer Emanzipation wird von Lohnarbeiter:innen in den entwickelten kapitalistischen Ländern kaum noch artikuliert. Wer das tut, gehört zu einer einflusslosen Minderheit, die obendrein in Sekten zersplittert ist und teilweise Ziele propagiert, deren praktische Umsetzung im Staatssozialismus man nur als antikommunistisch bezeichnen kann.
Man kann als individuelle Lohnarbeiterin in einem entwickelten kapitalistischen Land heute teilweise ein ganz passables Leben führen. Das ändert aber nichts daran, dass die Arbeits- und Lebensumstände der Lohnarbeiter:innen und Erwerbslosen weltweit beschissen sind und nach ökonomischer Befreiung verlangen. Die Notwendigkeit einer sozialrevolutionären Umgestaltung der Gesellschaft mit dem Ziel der „Kontrolle sozialer Produktion durch soziale Ein- und Vorsicht“ (Marx) auf der Basis von Gemeineigentum an Reproduktionsmitteln in Selbstverwaltung ist nicht vom Tisch.
Sie wird aber erst zu einer praktischen Notwendigkeit vor dem Hintergrund einer tiefen Krise der von Kapitalverwertung abhängigen gesellschaftlichen Reproduktion. Es ist dabei ganz gleichgültig, ob diese Krise sich einstellt als Resultat spontaner Marktentwicklung, der Zerstörung der stofflichen Lebensgrundlagen auf diesem Planeten oder als Resultat von protektionistischer Staatsintervention in den „freien Markt“, wie sie Trump und Konsorten gerade in die Tat umsetzen. Letztlich ist das ganze Schlamassel ein Produkt des Privateigentums.
Gemischt sind meine Gefühle, weil ich einerseits die Bedrohung sehe, die von einer tiefen Krise der gesellschaftlichen Reproduktion ausgeht, und andererseits die geringen Chancen für eine soziale Revolution. Diese Chancen werden außerdem dadurch getrübt, dass die Macht in Händen von einem Typen wie Trump für eine weltweite Rechtsentwicklung steht, die entweder bereits in etlichen Ländern solche Reaktionäre an die Macht gebracht oder zumindest bedrohlich gestärkt. Sofern sich dagegen überhaupt Widerstand entwickelt, will er jene Formen bürgerlicher Demokratie erhalten, in deren Schoß ebendiese reaktionären Kräfte erstarken. Wie die „Krise der Demokratie“ und der für sie einstehenden Parteien mit der immer bedrohlicheren Entwicklung der Kapitalakkumulation zusammenhängt, die immer neue Probleme schafft, ohne dass die Politik auch nur eines von ihnen wirklich lösen könnte, wird in aller Regel ignoriert. Das Bekenntnis zum Privateigentum verbindet letztlich die Reaktionäre mit den Liberalen und Sozialliberalen. Ohne radikale Kritik am Privateigentum hat der Widerstand gegen die Rechtsentwicklung wenig Aussicht auf Erfolg.
- 1. Kürzlich warnte der langjährige Generaldirektor der Welthandelsorganisation Roberto Azevdo: „Erinnern Sie sich, was in den 1930er-Jahren passierte, als die USA die Zölle mit dem Smoot-Hawley-Zollgesetz angehoben hatten und sich dann die anderen Länder mit Gegenzöllen rächten? Es kam zu einer weltweiten Zoll-Eskalation. Und wir verloren zwei Drittel des weltweiten Handels in nur fünf Jahren.“
- 2. Über den „Arcchitekten“ von Trumps Zoll-Politik (Peter Navarro) sagt eine andere geistige Größe aus Trumps Mannschaft (Elon Musk), er sei „wirklich ein Idiot“ und „dümmer als ein Sack Ziegel“. (Vgl. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/musk-kritik-100.html.)
- 3. Vergleiche zu den hier angesprochenen Punkte auch mein Arbeitsmanuskript über Freihandel, Protektionismus und Kapitalakkumulation: https://www.robert-schlosser.de/Web_Buchprojekt/_private/Freihandel%20und%20Protektionismus.pdf.
- 4. Karl Marx, Friedrich Engels: Revue, in: MEW, Bd. 7, S. 440.
Erstveröffentlicht im Portal communaut am 3.5. 2025
https://communaut.org/de/golden-age-coming
Wir danken für das Publikationsrecht.