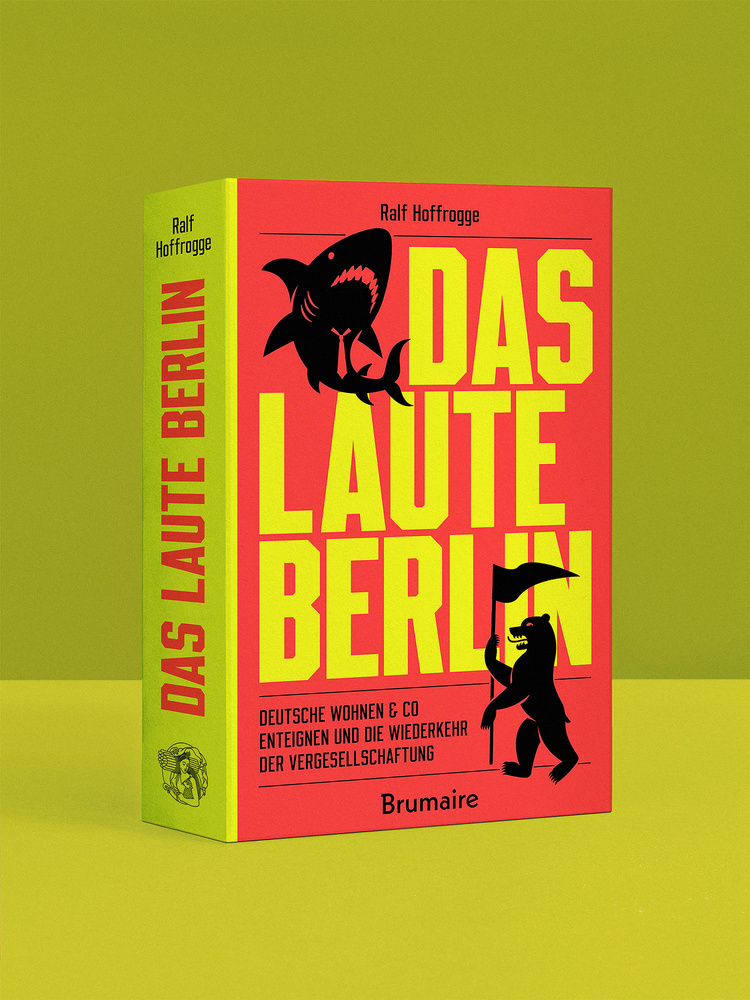Linke Strategie: Warum Umverteilung durch Vergesellschaftung ergänzt werden sollte
Von Ralph Hoffrogge
Hohe Mieten, teure Lebensmittel – niedrige Renten und Löhne. Weil sie diesen Widerspruch offen aussprach, schaffte die Linkspartei im Bundestagswahlkampf 2025 ein sensationelles Comeback. Ihr Spitzenduo versprach »eine andere Wirtschaftspolitik«, »damit das, was wir gemeinsam erarbeiten, auch fair verteilt wird«. Doch ändert sich dann die Arbeit selbst oder ändern sich gar die Eigentumsverhältnisse? Oder geht es allein um eine Umverteilung des Überschusses? Beides schließt sich nicht aus – doch zeigt sich eine Lücke zwischen Tagesforderung und Transformation, die geschlossen werden muss.
Antifaschistische Wirtschaftspolitik
Der von der Linken erhobene Ruf nach Wiedereinführung der Vermögenssteuer ist eine alte Forderung der SPD. Der Mietendeckel eine Preiskontrolle, wie sie die Ökonomin Isabella Weber vorgeschlagen und nach der Wahl Trumps als »antifaschistische Wirtschaftspolitik« gerahmt hat. Beide Maßnahmen sind notwendig, verlassen jedoch nicht den keynesianischen Korridor, in dem sich die Linke seit ihrer Gründung 2007 bewegt. Sie wollte die Sozialdemokratie beerben – und bekam all ihre Dilemmata. Schon oft ist kritisiert worden, dass Verteilungspolitik die Funktionsweise des Kapitalismus nicht außer Kraft setzt. Wenn die Steuerlast von Löhnen auf Unternehmensgewinne umgeschichtet werden soll, ist der Staat auf profitable Unternehmen angewiesen. Daraus ergibt sich das Dilemma linker Standortpolitik: Vor Ort will man blühende Unternehmen, global den Kapitalismus überwinden. Dieses Problem hat die Sozialdemokratie dahin gebracht, wo sie heutzutage ist. Bereits 1981 beugte sich Kanzler Helmut Schmidt einer Unternehmerkampagne über die »Grenzen des Sozialstaats«. Er setzte per Sparhaushalt Austerität durch, während seine Partei noch über Wirtschaftsdemokratie diskutierte. Ebenso verfuhr der rot-rote Berliner Senat von 2002 bis 2011. Selbst ein gestandener Sozialist wie Gregor Gysi, damals kurzzeitig Wirtschaftssenator, konnte sich den Zwängen nicht entziehen.
Das Kapital selbst umverteilen
Um alte Fehler nicht zu wiederholen, braucht die Linke eine Wirtschaftspolitik, die an ihre sozialistische DNA anknüpft. Sie darf Umverteilung nicht aufgeben, denn diese nützt den Arbeitenden schnell und konkret. Doch braucht es darüber hinaus eine Perspektive für den ökonomischen Systemwechsel. Sie darf nicht akademisch bleiben, sie muss laut sein und durchdringen. Eine Blaupause dafür liefert die Mietenbewegung. Sie hat linkssozialistische Forderungen aus den 1920er Jahren abgestaubt und wieder politikfähig gemacht. Etwa die Erneuerung der »Hauszinssteuer« – jene 1924 eingeführte Steuer auf Mieteinnahmen, die den öffentlichen Wohnungsbau von Architekten wie Bruno Taut ermöglichte. Die Mietenbewegung verlangte öffentliche Gelder nur für kommunale Wohnungen und durchbrach damit die Logik von Bauen als Konjunkturförderung, bei der der Staat bestenfalls soziale Preisbindungen für einige Jahre erkaufte. Zwischen 2016 und 2021 reaktivierte die Mietenbewegung schließlich Forderungen nach Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft, verlangte eine Überführung von Wohnungen privater Wohnkonzerne in öffentliches Eigentum. Umverteilt würden damit nicht Gewinne – sondern das Kapital selbst. Damit ging die Mietenbewegung über Bewegungen für Rekommunalisierung hinaus, die den antineoliberalen Protestzyklus der 2000er Jahre geprägt hatten. Gleichzeitig griff sie globale Finanzakteure direkt an. Die Mietenbewegung bemühte gegen die Zwänge der Globalisierung nicht den nationalen Wohlfahrtsstaat – ein Dilemma, das nicht nur Wagenknechts Linkskonservatismus, sondern auch humanere Konzepte wie das Grundeinkommen plagt.
Bewegungen für Vergesellschaftung
Im Volksentscheid der Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen« stimmte 2021 in Berlin eine Mehrheit für die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsunternehmen. Die Vergesellschaftungsforderung wurde bisher nicht umgesetzt – und zeigt doch Wirkung. Das Gespenst der Enteignung führte zur Rekommunalisierung mehrerer zehntausend Wohnungen in Berlin und erzeugte jenen Druck, der die Einführung des Mietendeckels 2020 möglich machte.
Nach dem Berliner Volksentscheid gab es Anläufe einer breiteren Bewegung für Vergesellschaftung. Im Jahr 2021 gründete sich die Initiative »Hamburg enteignet«, die einen ähnlichen Volksentscheid für die Hansestadt anstieß. Nach der ersten Unterschriftensammlung im März 2023 liegt das Vorhaben nun vor Gericht, die Bewegung ist ausgebremst. Im Energiesektor gründete sich die Kampagne »RWE & Co enteignen«, die einen der größten deutschen Stromkonzerne in Gemeineigentum überführen will, um ihn von der Braunkohle loszueisen. Eine Vergesellschaftungskonferenz in Berlin wurde 2022 zum Diskussionsforum für Klima- und Mietenbewegung, es gab mehrere Fortsetzungen. Auch im Gesundheitssektor gab es Kämpfe für Gemeinwirtschaft: Rund 18 000 Menschen forderten 2021 in einer Petition an den hessischen Landtag die Vergesellschaftung der Universitätskliniken Gießen und Marburg. Im selben Jahr sammelten Mitglieder der Berliner Krankenhausbewegung Unterschriften für »Deutsche Wohnen & Co enteignen«.
Bleibt die parlamentarische Linke bei Verteilungspolitik stehen, wird sie sich im Gewirr marktwirtschaftlicher Sachzwänge verheddern.
Wohnen, Energie und Gesundheit sind Sektoren, in denen sich Keime einer Vergesellschaftungsbewegung herausbildeten. Es geht um Bereiche, die nicht wegglobalisiert werden können. Anders als in der klassischen Arbeiterbewegung stehen meist die Nutzerinnen und Nutzer auf für Gemeineigentum – nur die Krankenhausbewegung wird von den Beschäftigten getragen. Obwohl Vergesellschaftung bisher eher eine Bewegung der Konsumierenden ist, liegt ihr Fokus auf dem Eigentum an Produktionsmitteln.
Dies hat besonders in der Klimabewegung eine konsumistische Perspektive korrigiert. Grüne Klimapolitik bedeutete bisher höhere Preise: Die Erneuerbare-Energien-Umlage erhöhte den Strompreis, die energetische Modernisierung die Miete, der CO2-Preis ist ein Joker, der alle Warengruppen verteuern wird. Erst spät kam die Forderung auf, dies mit einem Klimageld zu korrigieren. Vergesellschaftung kann diese Schieflage richten, die Treibstoff für rechte Hetze ist. Sie verteilt Gewinne nicht erst um, wenn diese in der Bilanz eines Unternehmens oder auf dem Konto der Aktionäre auftauchen – sondern richtet die Arbeit der Beschäftigten direkt auf einen sozialen Zweck aus.
Damit geht sie zwei weitere Probleme an, die die Linke nie so recht gemeistert hat: die Demokratisierung der Produktion und ihre Planung. Der Klimakollaps zeigt, wohin ungeplante, von oligarchischen Klüngeln kontrollierte Produktion führt. Dennoch ist es weiterhin »common sense«, dass das Problem mit dem Klima in unreguliertem Konsum liegt und durch Marktmechanismen wie CO2-Märkte gelöst werden könnte.
Die keimende Vergesellschaftungsbewegung ist jedoch ins Stocken geraten, weil ihr Druckmittel fehlen. Im Gesundheitsbereich steht den Beschäftigten vor allem der Streik als Druckmittel zur Verfügung. Sie konzentrieren sich bislang jedoch auf tariffähige Forderungen wie Entlastungstarifverträge, teils auch Rekommunalisierung. Vergesellschaftung ist präsent, aber randständig. Gewerkschaften unterstützten Vergesellschaftung, doch entwickelten sie noch keine eigene Praxis dazu. Selbst fortschrittliche, für Vergesellschaftung offene Kräfte in den Gewerkschaften sind vollends beschäftigt mit Abwehrkämpfen gegen Unternehmeroffensiven und staatliche Austerität.
Auch in der Klimabewegung ist Vergesellschaftung bisher eher Diskurs als Praxis, weil es nicht gelang, einen Volksentscheid ähnlich wie beim Wohnen zuzuschneiden oder anderweitig Druck aufzubauen. Selbst der Berliner Vergesellschaftungs-Volksentscheid konnte bislang ignoriert werden, weil hinter ihm eine Bevölkerungsmehrheit, aber bisher keine parlamentarische Mehrheit steht. Will die Vergesellschaftungsbewegung an Fahrt gewinnen, muss sie sich auf die Machtfrage konzentrieren. Dabei ist sie mehr denn je auf Unterstützung aus den Parlamenten angewiesen.
Dies bringt Chancen für die Linke, aber auch Risiken. Die Linke kann auf absehbare Zeit nur in Koalitionen regieren. Und auch deren Politik wird durch Gerichte zurechtgestutzt, wie beim 2021 gekippten Berliner Mietendeckel. Dennoch muss eine parlamentarische Linke die Eigentumsfrage nicht nur stellen, sondern beantworten. Bleibt sie bei Verteilungspolitik stehen, wird sie sich im Gewirr marktwirtschaftlicher Sachzwänge verheddern. Eine denkbare Strategie gegen den Markt wären Konzepte der schrittweisen Sozialisierung: Rekommunalisierungen im Verein mit Regulierungen, die Wohnen, Gesundheit und Wasserversorgung für Investoren unattraktiv machen. Auf dem Wohnungsmarkt könnte das von Linken und Grünen in Berlin diskutierte »Sicher-Wohnen-Gesetz« so eine Rolle spielen. Es würde das Vermieten regeln – und Eigentümer unter anderem verpflichten, ein Drittel ihrer Bestände zu leistbaren Mieten an Haushalte mit Wohnberechtigungsschein zu vermieten. Dies nützt den Mietenden, würde die Immobilienpreise senken und Rekommunalisierung erleichtern – und die Entschädigung im Vergesellschaftungsfall senken. Kann es gelingen, Umverteilung zu ergänzen? Etwa durch eine Kombination aus Polemik gegen den Markt, Regulierungsvorschlägen und Perspektiven für Sozialisierung? Dies würde ein Dilemma der Linken lösen – und vielleicht den stotternden Motor der Vergesellschaftungsbewegung neu starten.
Ralf Hoffrogge ist Historiker und aktiv in der Berliner Mietenbewegung. Im September erscheint im Brumaire-Verlag sein Buch »Das laute Berlin – Deutsche Wohnen & Co enteignen und die Wiederkehr der Vergesellschaftung«.
Erstveröffentlicht im nd v. 25.7. 2025
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1192857.sozialisierungs-konzepte-gegen-den-markt.html?sstr=Hoffrogge
Wir danken für das Publikationsrecht.