Die umfassenden Analysen von Jörn Rieken lassen kaum einen Zweifel: Sanktionen sind ein Instrument von Wirtschaftskriegen. Oft sind ihre Auswirkungen sogar noch verheerender als die von „heissen“ Kriegen. Für einen Sozialisten gibt es keine „guten“ Sanktionen des eigenen kapitalistischen Landes oder imperialen Blocks gegen deren Konkurrenz. Ebenso wenig wie es „gute Kriegskredite“ gibt. (Peter Vlatten)
Bei Sanktionen geht es letztlich um eine neoliberale Umverteilung im globalen Maßstab
Die Verhängung wirtschaftlicher Strafmaßnahmen erreicht nur in Ausnahmefällen die vorgeblichen Ziele einer Veränderung von Regierungshandeln der sanktionierten Länder. Im Kern geht es bei den Sanktionen um die Aufrechterhaltung westlicher Dominanz gegenüber drohender Multipolarität.
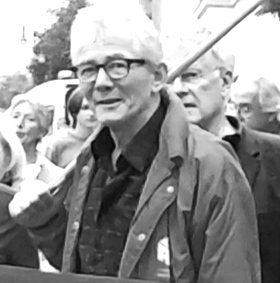
arbeitete als Entwicklungsökonom über 25 Jahre im Ausland für GIZ, EU und UNO mit Schwerpunkt multilateraler Handelsabkommen.
Der hier veröffentlichte Artikel ist
die gekürzte Fassung eines Textes
aus der jüngsten Ausgabe des
außenpolitischen Journals Welttrends.de, das einen Themenschwerpunkt »Globaler Wirtschaftskrieg« enthält. Eine noch ausführlichere Fassung sowie weitere Informationen befinden sich ebenfalls auf Welttrends.de. Jörn Rieken gehört zum Autorenkreis von FGLB und ist Aktivist der IG BAU.
Weitgehende Umlenkungsmöglichkeiten der Handelsströme, eine massive Stärkung der innenpolitischen Reputation und mangelnde Konditionierung von wirtschaftlichen Strafmaßnahmen führen im Gegenteil eher zu einer Stärkung von Regierungen in den sanktionierten Ländern.
Weltweit Hauptleidtragende sind die ärmeren Bevölkerungsteile und die energieabhängige industrielle Produktion. Es ist eine neoliberale Umverteilung im globalen Maßstab. Bezogen auf die innerstaatlichen Verhältnisse droht der sanktionsgetriebene Weltwirtschaftskrieg zu sozialen Kriegen zu führen.
Handelspolitik ist immer auch Interessenpolitik – bestenfalls zum Gesamtnutzen der beteiligten Länder, oftmals jedoch nur für deren Eliten. Sanktionen setzen die in der Welthandelsorganisation (WTO) einstimmig ausgehandelten und vertraglich fixierten Regelungen außer Kraft. Nicht zuletzt deshalb ermächtigt das Völkerrecht einzig den UN-Sicherheitsrat dazu, Sanktionen zu verhängen.
„Unilateral verhängte wirtschaftliche Strafmaßnahmen“, so die offizielle Bezeichnung von nicht durch die UN genehmigte Sanktionen, hingegen „stellen eine einseitige kollektive Bestrafung dar“ und wurden daher bereits 2013 von der UN-Generalversammlung als Menschenrechtsverletzungen verurteilt.
Mit seinem Beschluss vom 27. März 2023 stellte der UN-Menschenrechtsrat noch einmal fest, dass Sanktionen völkerrechtlich verboten sind und gegen das Internationale, das Menschen- und das Humanitäre Recht verstoßen. Auch darüber hinausgehende Maßnahmen, wie die Eingriffe in internationale Zahlungssysteme und die Beschlagnahmung von Konten, verstoßen ganz offen gegen internationale Abkommen und die Grundprinzipien des internationalen Rechts.
Ein entsprechender Bericht an die 17. Generalversammlung der UN stellte 2015 fest, dass „unilateral verhängte Maßnahmen, besonders Handelsembargos, schwere nicht-intendierte Folgen auf Menschenrechte, öffentliche Wohlfahrt und langfristige Wachstumsperspektiven für die betroffenen Länder haben.“
Der UN geht es nicht um rückwärtsgewandte Bestrafung, sondern um Erzielung eines Friedens. Daher wurden bei UN-Sanktionen zeitliche Begrenzungen mit regelmäßigem Monitoring eingeführt. Bei einer Bewertung des Nutzens von Sanktionen kann nicht allein deren Effektivität in Betracht gezogen, sondern es müssen auch die Kosten für sanktionsverhängende Staaten berücksichtigt werden.
Die bisher umfangreichste Studie wurde von Hufbauer et al. im Jahr 1990 erstellt und 2000 erneuert. In über 115 Fällen haben Sanktionen nur in einem Viertel der Staaten grundlegende politische Veränderung erzwingen können.
Allerdings führten wirtschaftliche Strafmaßnahmen in mehr als der Hälfte der Staaten zu einer Destabilisierung des Ziellandes. Nach der Neuauswertung 2000 konnte ein klarer Erfolg gemäß der ursprünglichen Zielsetzung in nur 5 von 115 Fällen beschrieben werden.
Unilaterale Sanktionen
In fundamentaler Abgrenzung zu UN-legitimierten Sanktionen leistet sich der Westen „eine Art idealistischen Oberschusses“ an sanktionspolitischem Unilateralismus.
Auch aufgrund ihrer empirisch belegten geringen Erfolgsbilanz weisen sie eine Tendenz zu Verhärtung und Eskalation auf. Praktisch gefangen in einer immanenten Eskalationsdynamik können USA und EU nicht aufhören, immer weitere Maßnahmen zu verhängen in der Befürchtung, ansonsten keine weiteren Optionen mehr zu haben.
Gemäß einer Untersuchung des Instituts für Wirtschaftsforschung Ifo zu Sanktionen mit dem Stand von 2020 stellen die Autoren fest, dass westliche Demokratien die häufigsten Urheber von Wirtschaftssanktionen sind, vor allem die USA und EU, während afrikanische Länder die häufigsten Sanktionsziele sind.
Seit Ende des Kalten Kriegs hätten Wirtschaftssanktionen rapide zugenommen. Eindeutige Folgen zeigten sich als Kollateralschäden in sinkender Lebenserwartung in den sanktionierten Ländern, bei Frauen stärker als bei Männern.
Bereits heute sind die Kosten für den sanktionierenden Westen im Falle Russlands und Chinas evident. Baldwin wies in seiner Auswertung von Sanktionen bereits im Jahr 2000 darauf hin, dass die Bedeutung von Kosten anerkannt werden müsse, „Pyrrhus-Siege seien kein Erfolg (…); es benötige komplexere Konzepte als den Sieg“.
Auch der IWF konstatierte bereits im Juni 2022, dass „die gegenwärtigen Wirtschaftssanktionen weltweit sogar größere Schocks auslösen würden als je zuvor“.
Trotz dieser eindrücklichen Warnungen mutiert das sanktionspolitische Instrumentarium zunehmend zum „Standrepertoire der Außenpolitik“. Im Juni 2004 veröffentlichte die EU ein die Sanktionen betreffendes Konzept zu den „Basic Principles on the Use of Restrictive Measures“, in dessen Mittelpunkt zielgerichtete Sanktionen stehen. Unter diesen „smart sanctions“ werden insbesondere individuelle Finanz- und Reisesanktionen beschrieben.
Europa degeneriert zum Vasallen der USA
In aller Offenheit hatte der frühere Präsident Bush den Einsatz wirtschaftlicher Strafmaßnahmen damit begründet, dass „es das oberste Ziel der US-Strategie nach dem Ende des Kalten Kriegs sein muss zu verhindern, dass irgendwo auf der Welt irgendeine Macht zum ebenbürtigen Konkurrenten wird.“
Gemäß dem gegenwärtigen Präsidenten Biden werden derzeit vom Westen „beispiellose Sanktionen“ eingeführt, die „in ihrer Gesamtheit die Potenz entfachen, Schäden zuzufügen, die der Anwendung militärischer Macht gleichkommen“.
Die EU folgt mit ihren Maßnahmen dem Sanktionsregime der USA, meist mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Die Gründe hierfür lägen in der „maßgeblichen Rolle des US-Dollars“ und der „amerikanischen Kontrolle über das internationale Finanzsystem“.
Für eine „strategische Autonomie der EU bleibe daher keinerlei Raum“, diagnostiziert der European Council on Foreign Relations (ECFR), das wichtigste Beratungsgremium der Europäischen Kommission. Und konstatiert eine zwangsläufig „erfolgende Vasallisierung Europas“.
Gezielte Sanktionen
Neben den allgemeinen ökonomischen Strafmaßnahmen setzen USA und EU vorwiegend auf sogenannte „gezielte“ Sanktionen gegen Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen. Betrug deren Anzahl vor Februar 2022 noch rund 2.700, so zählte Castellum AI im August 2023 fast 15.000 allein gegen Russland.
Bereits im Ersten Sanktionspaket der EU wurden sämtliche 351 Abgeordnete des russischen Parlaments mit Sanktionen belegt, die für die Anerkennung der „Volksrepubliken“ gestimmt hatten. Auch 27 Banken und Unternehmen, denen Geschäfte mit den separatistischen Gebieten unterstellt wurden, trafen die Strafmaßnahmen, ebenso sowie Moderatoren von Nachrichten und Talkshows.
Dabei werden wirtschaftliche Strafmaßnahmen von einem exklusiven Kreis an EU-Entscheidern beschlossen, zu deren Begründungen selbst EU-Parlamentarier keinen Einblick erhalten.
Auch auf den Widerspruch von EU-Mitgliedstaaten wie Ungarn, einzelne Personen auszunehmen, wurde nicht reagiert. Für sanktionierte Einzelpersonen bestehen keinerlei Anreize zu Verhaltensänderungen, selbst wenn sie es könnten. Auch „gezielte“ wirtschaftliche Strafmaßnahmen sind damit als „Vergeltung ohne Zielsetzung“ zu beschreiben.
Umgehungsstrategien
Wenn mit sogenannten „gezielten“ Sanktionen gegen Einzelne also nur symbolische oder unspezifische Effekte erzielt werden können, verbleiben noch wirtschaftliche Strafmaßnahmen.
Effektiv können Exportbeschränkungen aber nur dann wirken, wenn sie unter weltweiter Beteiligung möglichst vieler Im- und Exporteure erfolgt. An den vom Westen gegen Russland auferlegten Sanktionen beteiligen sich allerdings außer den USA, Kanada und den 27 EU-Staaten nur noch acht weitere Länder.
Einige Länder des Globalen Südens hingegen profitieren von den bis zu 30 Prozent betragenden Rabatten auf von ihnen importierte Rohstoffe. Trotz Preisabschlägen für nicht-westliche Abnehmer konnte Russland seine Exporteinnahmen im Jahre 2022 drastisch ausweiten und auch 2023 bei geringerem Handelsvolumen höhere monatliche Einnahmen erzielen als vor 2021.
Selbst der IWF bescheinigt Russland eine ausgesprochen stabile finanzielle Situation, niedrige öffentliche Verschuldung und hohe Leistungsbilanzüberschüsse. Auch wenn die Einnahmen aus Energieexporten 2022 um fast ein Viertel zurückgingen, erwartete der Fonds für 2023 ein russisches Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent.
Umgehungsstrategien erwiesen sich bisher als recht erfolgreich. In der Sanktionsliteratur wird immer wieder auf die begrenzte Effektivität unmittelbarer, das sanktionierte Land direkt betreffender Strafmaßnahmen hingewiesen.
In vielen Artikeln wird beschrieben, dass – gemessen an den deklarierten Zielsetzungen – Kubas wirtschaftliche Entwicklung, selbst nach Wegfall der sowjetischen Unterstützung, relativ stabil weitergelaufen wäre, Nordkoreas technologische Entwicklung bisher weitgehend ungestört verlaufe, und Iran sich wirtschaftlich und geopolitisch zur regionalen Mittelmacht entwickeln konnte.
Im Fall Nordkoreas waren wirkungsvoll einzig die extremen humanitären Kosten für den ärmeren Teil der Bevölkerung. Auch in Kuba und Iran wurde ein Großteil der Kosten auf die ärmere Bevölkerung abgewälzt.
Ein vollkommenes anderes Bild ergibt sich für sanktionierte Länder mit geringerer wirtschaftlicher Entwicklung.
Der Menschenrechtsbeauftragte der UN, Volker Türk, konstatierte im Januar 2023, „dass die seit 2017 gegen Venezuela verhängten sektoralen Sanktionen die Wirtschaftskrise verschärft und die Menschenrechte beeinträchtigt haben“.
Noch drastischere humanitäre Auswirkungen zeigen sich in Afghanistan. Dessen Wirtschaft wurde der endgültige Todesstoß versetzt, als die Reserven der Zentralbank durch USA und EU eingefroren und das Land vom Zahlungsdienstleister Swift ausgeschlossen wurde. Während die UN vor „einer der umfassendsten humanitären Krisen, die die Welt je sah“ warnen, sind die Unama-Mittel für Afghanistan nur zu 30 Prozent finanziert.
Bereits im März 2022 warnte der IWF vor dem Risiko einer dauerhaften Fragmentierung der Weltwirtschaft in geopolitische Blöcke mit unterschiedlichen technologischen Standards, Zahlungssystemen und Reservewährungen.
Die vom IWF vorausgesagte „tektonische Verschiebung“ würde hohe Anpassungskosten und anhaltende wirtschaftliche Effizienzverluste mit sich bringen, da Lieferketten und Produktionsnetzwerke neu ausgerichtet werden müssten.
Hier deuten sich Parallelen an zum endgültigen Zusammenbruch des Goldstandards 1931, als sich vier Währungsblöcke herausbildeten, die untereinander kaum verbunden waren.
Der internationale Handel reduzierte sich bis 1938 um mehr als 60 Prozent, die bis dahin hohe Intensität weltwirtschaftlichen Integration ging deutlich zurück. Erst in den 1970er Jahren wurde wieder das Niveau von 1914 erreicht.
Sanktionen im Energiesektor
Die Nachrichtenagentur Bloomberg berechnete bereits im Dezember 2022 die Kosten von Energiesanktionen für die EU auf eine Billion US-Dollar. Nach Angaben der Brüsseler Denkfabrik Breugel hat die EU Unternehmen und Verbrauchern bereits 2022 mit 700 Milliarden US-Dollar geholfen, einen Großteil der Preisanstiege abzufedern, „aber der Ausnahmezustand könnte noch Jahre andauern“.
Allein für Deutschland beliefen sich damals bereits sanktionsbedingte Kosten auf mehr als 440 Milliarden Euro.
Für die sanktionierenden Länder erwartete die OECD schon Mitte 2022 eine nachhaltige Schädigung des Konsums durch einen starken Verlust an Kaufkraft, eine lang anhaltende Rezession und den Rückgang von Investitionen.
Auch die Weltbank befürchtete wenig später eine Rückkehr zur Stagflation in Analogie zu den 1970er-Jahren, die von schwachem Wachstum in Kombination mit hoher Inflation geprägt waren.
Das Institut der Deutschen Wirtschaft sah EU und BRD bereits Ende 2022 als krisenbedrohte „wirtschaftliche Großmacht“. Nach den Krisen bei Banken, des Euro und der durch die Pandemie ausgelösten drohe nunmehr mit der Sanktionskrise ein lang anhaltender wirtschaftlicher Verfall.
Auch das IW formuliert, dass der „Zugang zu günstigen Rohstoffen wie Energiequellen“ einen schwer wettzumachenden Standortnachteil gegenüber den USA darstelle.
Aufgrund längerfristig mehr als dreifach höherer Energiepreise erwartet der DIHK eine „strukturelle Krise“ mit dem Potenzial, „Teile der wirtschaftlichen Struktur zu zersetzen“ sowie einer Verschiebung von Produktionsstandorten in Ausland.
In der öffentlichen Adressierung von Kostenträgern halten sich die meisten Regierungsvertreter noch zurück. Konkretere Formulierungen finden sich bereits in Wirtschaftskommentaren, nach denen die Friedensdividende aufgezehrt sei und daher die Sozialausgaben überprüft werden müssen.
Eindeutige Umverteilungseffekte zeigen sich bei den seit 2022 außerordentlichen Gewinnen vieler multinationaler Konzerne, besonders in den Branchen Energieversorgung und Nahrungsmittelverarbeitung. Dagegen mussten abhängig Beschäftigte in Deutschland mit 4,7 Prozent den „historisch“ größten Reallohnverlust seit dem Zweiten Weltkrieg hinnehmen.
Das WSI bezeichnet derweil die in so kurzem Zeitrahmen erfolgte Umverteilung von unten nach oben als „historisch“.
Sanktionen im Bereich Dienstleistungen
Bislang am effektivsten sind Sanktionen, die den Handel mit Dienstleistungen betreffen. So wurden im 7. Sanktionspaket der EU für den russischen Schiffstransport von Rohöl und Erdölprodukten Versicherungsleistungen nur noch bei Einhalten eines Preisdeckels für die exportierten Produkte erlaubt.
Diese Leistungen wurden vor 2022 zu 90 Prozent von EU- und britischen Firmen angeboten und die bedeutendsten Versicherer und Händler befinden sich in der EU, Großbritannien und der Schweiz.
Aufgrund rechtlicher Unsicherheit über den Geltungsbereich von Dienstleistungssanktionen haben sich mittlerweile auch alle westlichen Banken aus der Finanzierung von Handelsgeschäften zurückgezogen. Nicht betroffen sind allerdings Reedereien, da Griechenland Einspruch erhob.
Auch kann der Handel mit Rohstoffen aus Russland weitgehend ungestört weiterlaufen, da er vom bisher dominierenden Handelsplatz Schweiz nach Dubai umzog.
Keine Umgehungsmöglichkeiten hingegen gab es bei der Beschlagnahmung von auf ausländischen Banken deponierten Zentralbankreserven. Im Falle Irans, Venezuelas und Russlands hatte das für die betroffenen Länder zwar spürbare, bezogen auf deren Gesamtumfang jedoch begrenzte Folgen.
Der Ausschluss Jugoslawien aus dem Swift während dessen Zerfallsprozesses und die gleiche Maßnahme gegen Afghanistan heute hatte und hat gravierende Folgen für die gesamte Bevölkerung der betroffenen Staaten.
Auch in Kuba, Iran, Russland und Venezuela sind migrantische Arbeiter und private Personen für Überweisungen auf informelle Dienstleister mit oft sehr hohen Transaktionskosten angewiesen. Die regierungsberatende SWP konstatiert daher, dass es „unterschiedliche Auffassungen“ darüber gäbe, wer als ideale Zielgruppe anzusehen ist.
Erbitterte Konkurrenz
Aufgrund des Boykotts russischen Pipelinegases stiegt der LNG-Import Europas bis Anfang 2023 um 65 Prozent. Infolgedessen traten die europäischen Importeure in erbitterte Einkaufskonkurrenz mit ärmeren Ländern. Indien, Pakistan und Bangladesch verloren zusammengenommen rund 18 Prozent ihrer LNG-Importe.
Sogar vertraglich fest zugesagte Importe blieben aus, sodass Pakistan und Bangladesch wegen Erdgasmangels zeitweise Fabriken stilllegen und den privaten Konsum strikt beschränken mussten.
Noch 2021 belieferten Russland und die Ukraine den Weltmarkt mit rund 30 Prozent aller Weizen- und 20 Prozent aller Maisexporte. Mitte 2022 wurde das Abkommen über ungehinderte Getreidelieferungen der Ukraine über das Schwarze Meer ausgehandelt.
In dem Abkommen waren gleichfalls Bestimmungen enthalten, die einen sanktionsfreien russischen Getreideexport ermöglichen sollten. Dieser Teil des Abkommens wurde allerdings von der EU nicht umgesetzt. Aufgrund der Sanktionen waren anfangs nur wenige Reeder, Handelsbanken und Versicherungen bereit, russische Lieferungen zu ermöglichen.
Besonders betroffen sind arme Länder wie Somalia, in denen sich die Preise für Grundnahrungsmittel verdoppelten. Trotz dieser umfangreich dokumentierten Notlage soll der für 2024 geplante Etat der deutschen Entwicklungszusammenarbeit um 22 Prozent, das darin enthaltene Budget für humanitäre Hilfe sogar um 36 Prozent gekürzt werden.
Laut einer Studie der University of Edinburgh haben Düngemittel- und Energiepreise einen viel stärkeren Einfluss auf die Getreidepreise als punktuelle Exportschranken wie die Aussetzung des Getreidedeals.
Die weltweiten Düngerpreise verbleiben in Afrika bis heute auf dem dreifachen Niveau von 2021. Gemäß dem International Food Policy Research Institute (IFRI) sind rund 20 Prozent des weltweiten Düngerhandels von den Strafmaßnahmen betroffen.
Profitieren konnten hingegen die neun weltgrößten Düngemittel-Unternehmen, deren Gewinne von rund 14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 49 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 stiegen.
Über die Sanktionen beim Waren- und Dienstleistungshandel hinaus sollen westliche Wirtschaftsstrafmaßnahmen auch auf Restriktionen für Investitionen aus dem Ausland ausgedehnt werden. Untersagte Auslandsinvestitionen wurden von 2019 bis 2022 von nur wenigen Dutzend auf mehrere Hundert vervielfacht.
Zusätzliche Probleme dürfte künftig das in westlichen Ländern geplante Outbound Investment Screening schaffen. Faktisch würde es dazu führen, dass westliche multinationale Unternehmen ihre globalen Geschäfte in eine nordamerikanisch-europäische, eine chinesische und eine indisch-südostasiatische jeweils separat geführte Firma aufspalten müssten.
Deglobalisierung
Selbst die Präsidentin der EZB und die US-Finanzministerin warnen inzwischen vor dem sanktionsbasierten Gespenst der Deglobalisierung und seinen Folgen wirtschaftlicher Fragmentierung mit weniger Handel, geringerer Produktion und höherer Inflation.
Die Auflösung der bisherigen Handelsbeziehungen werde sich gravierend auf Länder mit niedrigem Einkommen und weniger wohlhabende Verbraucher in fortgeschrittenen Volkswirtschaften auswirken.
Im bundesrepublikanischen Kontext werden wirtschaftlichen Strafmaßnahmen dagegen als „wertebasierte Handelspolitik“ verbrämt und die angestrebte Entkoppelung als „friendshoring“ bezeichnet.
Der IWF schätzt, dass die gegenwärtige „geoökonomische Fragmentierung“ zu höherer makroökonomischer Volatilität, größeren Krisen und einer „finanziellen Regionalisierung“ mit einem fragmentierten globalen Zahlungssystem führe.
Bei starker Fragmentierung des Handels könnten Kosten von bis zu sieben Prozent anfallen, und bei zusätzlicher technologischer Entkopplung der Produktionsverlust in einigen Ländern bis zu zwölf Prozent betragen.
So untergräbt die Sanktionsallianz das Fundament der internationalen Arbeitsteilung und scdigt sich langfristig selbst.
Erstveröffentlichungen: ausführliche Fassung, gekürzte Fassung auf telepolis 11.11.23 und auf ND 27.11.23




