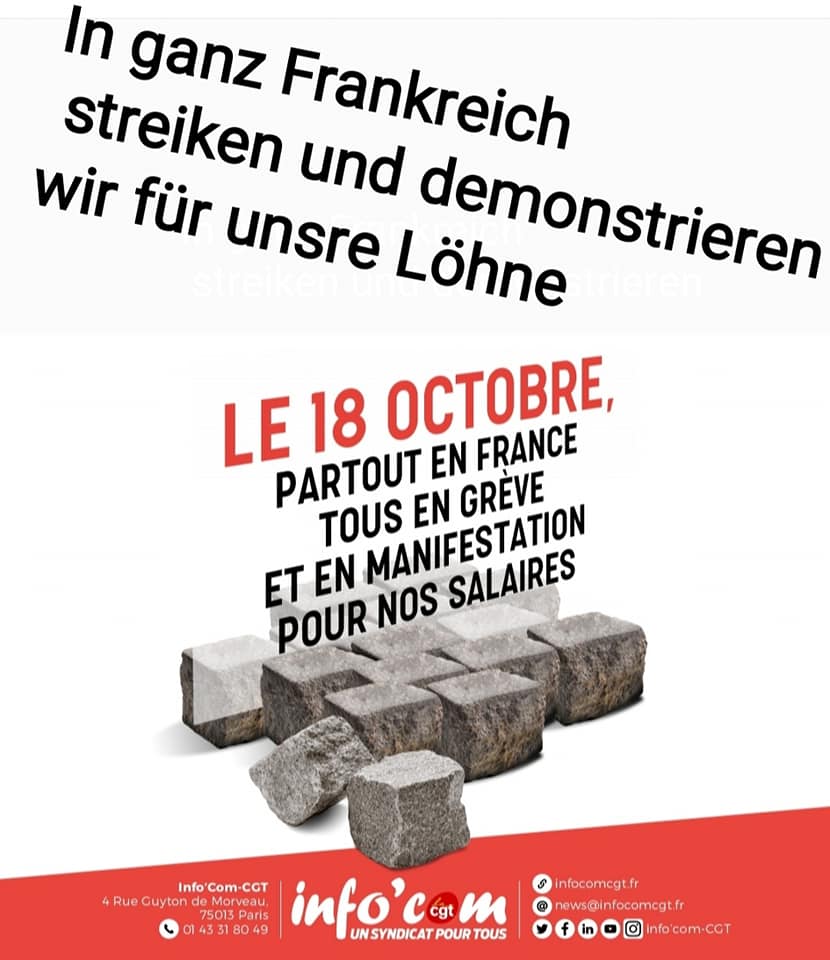Reportage von Bernard Schmid, 19.10.2022, der selbst Teilnehmer und „nüchterner“ Beobachter der aktuellen Streiks und Demonstrationen in Frankreich war ! Wir verweisen auf den ersten Teil „Raffineriestreik in Frankreich: Der Saftladen bleibt dicht“ und die Reportage „Gegen das teurre Leben“ (Peter Vlatten)
Berufsgruppenübergreifender Streiktag am Dienstag, den 18. Oktober 22 – Bilanz: durchwachsen. Rund 200.000 Menschen demonstrierten. Relativ geringfügige Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr über den gestrigen Tag hinaus; keine massive Streikfortführung. Drei Raffinerien noch durch einen Streik lahmgelegt (eine vierte „aus technischen Gründen“), sowie sieben Treibstoffdepots/Tanklager. Und: kurzer Rückblick auf den Protestzug von rund 50 bis 60.000 Menschen (reale Zahl) vom vorigen Sonntag, den 16. Oktober
Infolge der strafbewehrten Dienstverpflichtungen, die Mitgliedern des Personals der bestreikten Raffinerien am vorigen Donnerstag zugestellt wurden, riefen mehrere Gewerkschaftsverbände – zunächst die CGT, alsbald unterstützt durch die FSU (einen Verband von Gewerkschaften im Bildungssektor), die Union syndicale Solidaires (Zusammenschluss weitgehend linker Basisgewerkschaften) und den politisch schillernden Dachverband Force Ouvrière (FO, drittstärkster Dachverband hinter CFDT und CGT) – zu einem berufsgruppenübergreifenden Streiktag am gestrigen Dienstag, den 18. Oktober 22.
(Den durch diverse bürgerliche Medien gerne auf unbedarfte Weise benutzten Begriff des „Generalstreiks“ vermieden die Aufrufer/innen dabei wohlweislich. Dies aus drei Gründen: Erstens wussten die Dachverbandsführungen, dass ein echter Generalstreik nicht durch einen Aufruf „von oben“ innerhalb weniger Tage erzielt werden kann. Zum Zweiten ist ein echter Generalstreik ein Arbeitskampf, der alle oder fast alle Wirtschaftsbranchen und Sektoren umfasst; dies hat es zuletzt im Mai und Juni 1968 real gegeben, auch wenn etwa deutsche Medien marktschreierisch bei jedem Protesttag in den öffentlichen Diensten in Frankreich fälschlicherweise vom „Generalstreik“ faseln, was den Begriff seinen Bedeutungsgehalt verlieren lässt. Zum Dritten verwies die Generalstreik-Debatte im frühen 20. Jahrhundert auf das Konzept vom Generalstreik zum Regierungssturz, ja politischen Umsturz. Von einem solchen Szenario ist die aktuelle Situation doch momentan ziemlich weit entfernt…)
Die Lage am Streiktag war im Laufe dieses Dienstags insgesamt eher durchwachsen. Zwar fielen im Großraum Paris viele Vorortzüge und Busse aus. Die Métrozüge verkehrten jedoch in den zentraleren Bereichen weitgehend normal. Diesbezüglich haben die Verkehrsbetriebe seit dem massiven Herbststreik von 1995, in dessen Verlauf dreieinhalb Wochen lang keinerlei Züge und Busse verkehrten, organisatorisch hinzugelernt. Zunächst auf zwei, seit September dieses Jahres nunmehr auf drei Métro-Linien – die Paris sowohl in ost-westlicher als auch in Nord-Süd-Richtung durchqueren – verkehren inzwischen fahrerlose Züge, die wesentlich weniger für Arbeitskämpfe anfällig sind, da eine kleine Zahl von Beschäftigten in technischen Büros zu ihrem Betrieb genügt. (Es handelt sich um die Linie 14, die im Jahr 1996 neu und als von Anfang an fahrer/innen/lose Linie eingeweiht wurde; die Linie 1, die zu Anfang der 2000er Jahre in eine solche umgewandelt wurde; und zuletzt die Linie 4, auf welcher seit September d.J. auch, aber nicht nur fahrer/innen/lose Métro-Züge verkehren, nach nunmehr bald zweijährigen Umbauarbeiten.)
Bei der Bahngesellschaft SNCF fiel auf vielen Regionallinien am gestrigen Dienstag rund die Hälfte der Zugverbindungen aus, auf den wesentlich lukrativeren internationalen Linien fielen jedoch kaum Züge aus. Das Unternehmen hatte sich vorab organisiert, um mit den Streikfolgen umzugehen, doch falls der Streik im Laufe der Woche fortgeführt wird – dazu rief von Anfang an, und auch Teile der CGT sind dafür, in Vollversammlungen des Personals allabendlich über eine Einstellung oder Fortsetzung des Streiks abzustimmen -, könnte dies nach ein paar Tagen schwieriger werden. Allerdings kündigte die Bahngesellschaft für den heutigen Mittwoch, den 19. Oktober 22 an, dass der Bahnverkehr „weitgehend normal“ stattfinde. Einen wirklichen Schwung zur Streikfortführung scheint es nicht wirklich zu geben. Einen Faktor dabei benennt übrigens das Wochenmagazin Marianne: Viele Bahnbedienstete bereiten sich bereits mental auf einen späteren Streik gegen die bevorstehende Renten„reform“ vor, können es sich jedoch finanziell nicht leisten, zwei mal relativ kurz hintereinander für längere Zeit zu streiken und dadurch an Einkommen zu verlieren… /// Vgl. https://www.marianne.net/economie/protection-sociale/chez-les-cheminots-de-la-sncf-en-greve-on-naura-pas-les-moyens-de-se-mobiliser-deux-fois ///
Im laufenden Jahr hatte die SNCF die Löhne ihrer Beschäftigten bisher um 5,8 Prozent angehoben, was ziemlich nahe an der derzeitigen Inflationsrate liegt. Da vom 17. bis zum 24. November 22 bei der SNCF landesweite Personalratswahlen (durch elektronische Abstimmung) stattfinden, nimmt ein Teil der Beschäftigten und darüber hinaus der öffentlichen Meinung die derzeitige Mobilisierung als Profilierungsstreben der teilnehmenden Gewerkschaften wahr.
Mehrere Atomreaktoren waren ebenfalls vom Streik betroffen, etwa drei allein am nordfranzösischen Standort Gravelines, wo zwei Reaktoren heruntergefahren werden mussten und ein dritter, welcher zu Wartungszwecken stillliegt, später als bislang geplant wieder ans Netz gehen wird können. An den Schulen und anderen Lehranstalten waren insgesamt nur geringe Streikfolgen zu verzeichnen, mit Ausnahmen der Berufsschulen, wo es neben der allgemeinen sozialen Bewegung für Löhne und Inflationsausgleich auch spezifische Gründe gibt, da die Lehrkräfte sich gegen eine geplante „Reform“ des Berufsschulwesens stemmen. In Paris fanden an manchen Schulgebäuden, etwa am Vormittag im zwanzigsten Bezirk, Blockaden oder Blockadeversuchen von Schülerinnen und Schülern statt. Eine Oberschule (lycée) wurde infolge dessen geschlossen, an neun war der Unterrichtsablauf gestört.
Allerdings hat die aktuelle Streikbewegung mit einer starken Stimmungsmache in den Medien gegen ihre Arbeitskämpfe – wenngleich nicht gegen das Anliegen von Lohnerhöhungen an sich – zu kämpfen, die in Teilen der öffentlichen Meinung scheinbar verfängt. Umfragen sind wie stets mit Vorsicht zu genießen, da viel von der Präsentation der Fragen abhängt, doch eine erste demoskopische Erhebung des Instituts Elabe für den wirtschaftsliberalen Sender BFM TV soll – laut Darstellung durch seine Auftraggeber – ein Abbröckeln der Unterstützung zeigen.
Laut Elabe erklärten sich demnach zu Wochenbeginn 48 Prozent der Befragten negativ eingestellt zur laufenden Streikbewegung – das wären acht Prozent mehr als fünf Tage zuvor -, 40 Prozent positiv, das wären zwei Prozentpunkte weniger. (Dies betrifft die generelle Streikbewegung; für die TOTAL-Beschäftigten befürworten demnach 70 Prozent der Befragten eine Streikbeendigung.)
Unter den im aktiven Erwerbsleben stehenden Beschäftigten kehren sich die Proportionen allerdings um. Institutsleiter Bernard Sananès erklärte dazu in einer Sendung im Frühstücksfernsehen, die Verschiebungen ergäben sich vor allem daraus, dass „die Wählerschaft von Marine Le Pen und die Mittelklassen“ sowie die auf das Auto angewiesenen Einwohner/innen von Zonen außerhalb der Ballungszentren von Sympathie zu Antipathie wechselten. Der Sender, dem er seine Umfrage verkauft hatte und bei dem er sich äußerte, lässt ansonsten tagaus tagein frustrierte Autofahrer aus den Warteschlangen an den Tankstellen zu Wort kommen, von denen mittlerweile einige von „Geiselnahme“ durch die Streikenden faseln – wenn die Wartenden sich nicht untereinander prügeln, was inzwischen öfters vorkommt.
Auch ein Teil der Lohnabhängigen zeigt sich jedoch von einem Solidaritätsgefühl gegenüber der Streikbewegung zumindest bisher abgehängt, wozu auch die vom TOTAL-Konzern gestartete Neidkampagne beitrug. Diese beruhte darauf, dass über die Medien Faksimile von angeblichen Einkommensbelegen von Beschäftigten von TOTAL gestreut wurden, mit der Behauptung verknüpft, die Raffineriemitarbeiter verdienten 5.000 Euro im Monat. Bei dieser Zahl, die nur Höchstqualifizierte mit langer Betriebszugehörigkeit betrifft sowie alle Zulagen für Nacht- und Sonntagsarbeit mit umfasst, handelt es sich allerdings um keine repräsentative Angabe. Die CGT spricht ihrerseits davon, die Mehrzahl der Raffineriebeschäftigten verdiene eher 3.000 euro im Monat, und veröffentlichte ebenfalls Belege. Solche Angaben sind von außerhalb schwer zu überprüfen, verfingen jedoch in einem Teil der Öffentlichkeit, der sich gegenüber den Betreffenden unterprivilegiert fühlt. In den einschlägigen wirtschaftsliberalen Printmedien wie Fernsehsendern kommen unterdessen frustrierte Konsumenten zu Wort, die zur „Solidarität“ auffordern, damit aber nicht ein Mitstreiken meinen – sondern, hähähä, die Wiederaufnahme der Arbeit in den Raffinerien, um „gegen die Schwierigkeiten bei der Energieversorgung die Ärmel hochzukrempeln“.
Nur falls die soziale Bewegung eine noch breitere Dynamik entfaltet, könnten hier bislang zögernde Teile der Beschäftigten mitgezogen werden.
Ansonsten demonstrierten am gestrigen Dienstag laut Angaben des Innenministeriums frankreichweit 107.000 Menschen, in Paris allein 13.000 Menschen; die Veranstalter/innen sprachen ihrerseits von 300.000 Menschen frankreichweit. Die Größenordnung läge damit ungefähr bei jener vom gewerkschaftlichen Aktionstag am 29. September d.J. (damals: lt. Innenministerium frankreichweit 118.500 und laut Veranstalter/inne/n 250.000 Menschen); Labournet berichtete.
Protestzug „gegen das teure Leben und klimapolitische Untätigkeit“ vom Sonntag, den 16. Oktober 22
Nicht direkt im Zusammenhang mit den aktuellen Arbeitskämpfen stehend – der Aufruf zur Demonstration lag schon Wochen zuvor vor – und doch darauf Bezug nehmend, fand am Sonntag, den 16.10.2022 ein Protestzug von mehreren Zehntausend Menschen durch Paris statt. Auch er ist natürlich ein Bestandteil des Kräfteverhältnisses. Die Demonstration allein dürfte das Kräfteverhältnis zwischen Kapital & Arbeit nicht ändern – bei einer Million oder darüber hätte man ein anderes Urteil treffen können -, zeigte jedoch auf, dass es mobilisierbare soziale Kräfte gibt, die sich bündeln können. Sie stellte vielleicht keinen absoluten, doch zumindest einen relativen Erfolg dar.
Das Innenministerium sprach im Anschluss von 30.000 Teilnehmenden, die Veranstalter/innen von 140.000. Laut Beobachtungen des Verfassers dieser Zeilen dürften 50 bis 60.000 realistisch sein (die frankreichweit mobilisiert wurden, so liefen regionale Gliederungen der teils linkssozialdemokratischen, teils linksnationalistischen Wahlplattform LFI hinter Transparenten ihres jeweiligen Départements her: Tarbes in den Pyrenäen, Perpignan, Colmar, Strasbourg, Caen in der Normandie, Toulouse, Albi….).
————————————————–
KURZ ZU DEN ZAHLEN: Die Veranstalter-Angabe einerseits, die Polizeizahl bzw. Zahl des Innenministeriums dazu sind beides « politische » Zahlen und objektiv falsche Angaben. Die mathematische Wahrheit dürfte für Sonntag zwischen 50 und 60.000 liegen. Der Verfasser selbst hielt eine Zeit lang einen Beobachtungsposten auf der Kreuzung von Faidherbe-Chaligny im elften Pariser Bezirk; davor und danach lief ich selbst in der Demo mit. Der Protestzug brauchte dort, an der Stelle, von 16.05 bis circa 17.25 Uhr zum Vorbeiziehen, also rund achtzig Minuten. Definitiv konnten in dieser Zeit keine 140.000 Menschen vorbeiziehen, das ist objektiv absolut ausgeschlossen. Aber es war auch kein kleiner Protestzug.
Um eine objektive Einschätzung zu versuchen, möchte ich on durchschnittlich 25 Menschen pro Linie ausgehen. Also, die Straßenbreite gibt das an der Stelle her, wenn sie auf der ganzen Front durch die Demo eingenommen wurde. Allerdings war die Demonstration zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich breit und dicht. Am Anfang ging es eine Viertelstunde lang so zu, dass die Demonsgration nicht nur sehr dicht und kompakt war, sondern auch auf die Bürgersteige auf beiden Seiten hinter der Straße ausgriff, ganz kurze Zeit hindurch sogar auf eine kleine Nebenstaße. Vielleicht zehn Minuten lang gingen sicherlich im dichtesten Moment des Protestzugs fünfzig, ja sogar bis zu sechzig Menschen nebeneinander her. Das dauerte allerdings nicht lange. Danach wurde der Strom dünner, und nach einer guten Viertelstunde oder zwanzig Minuten würde ich eher davon ausgehen, dass danach nur noch zwanzig Menschen pro Reihe liefen (die Demo nahm nun nicht mehr die Bürgersteige ein – dort standen dann Zuschauer/innen, die nicht mitliefen – und blieb auf der zentralen Route), in stärker aufgelichteten Momenten auch mal fünfzehn Personen.
Wenn man nun einen Durchschnittswert von 25 Menschen pro Reihe zugrunde liegt, und von dreißig Reihen pro Minute ausgeht (was eine relativ optimistische Annahme darstellt), dann hätte man 750 Menschen pro Minute, die durchgehen konnten. Dadurch käme man auf 37.500 Menschen in fünfzig Minuten. Der Protestzug ging jedoch an der Stelle achtzig Minuten, da käme man dann auf 60.000. Objektiv ist das jedoch hoch gegriffen, u.a. gab es zwischendurch auch Minuten, in denen der Demozug stehen blieb, und Löcher, etwa wenn man Lastwagen / Fahrzeuge (Lautsprecher- oder Kundgebungswagen) durchfahren ließ.
Insofern dürfte, in meiner Schätzung, ein Wert zwischen 50. und 60.000 herauskommen.Ein Freund, der schon in den 1970er Jahren in der radikalen Linken aktiv war, sprach seinerseits im Nachhinein von « 30.000 bis 40.000 », doch kenne ich die Details nicht, auf denen seine Einschätzung beruht.
Das ist näherungsweise die Wahrheit. Die « 140.000 » hingegen sind pure Propaganda… Nun können gerne Veranstalter/innen für ihre politische Zwecken mehr oder minder aufgeblähte Zahlen benutzen. In einer analytischen Diskussion hat hingegen Propaganda nichts zu suchen, sonst wird die Analyse zur Lüge.
——————————————————————
Aufgerufen unter dem Motto 《 Gegen das teure Leben und klimapolitische Untätigkeit 》hatte zunächst die linkspopulistische Wahlplattform LFI („Das unbeugsame Frankreich“) unter Jean-Luc Mélenchon; ihr schlossen sich weitere Linkskräfte, Umweltgruppen und auch Gewerkschaftsmitglieder an. Die Gewerkschaften als solche mochten jedoch nicht als Aufrufer/innen firmieren.
Mélenchon kommt ursprünglich aus dem sozialdemokratischen Establishment und war von 2000 bis 02 Berufsschulminister, ist heute jedoch mit Verbalradikalität um politische Profilierung bemüht. Am Dienstag mittag (18.10.2022) sprach er auf einer Streikversammlung von Eisenbahnern am „Lyoner Bahnhof“ in Paris [wie 1995 vor ihm am selben Ort Pierre Bourdieu]. Dort kündigte er vor laufenden Kameras ein „1968 in Raten“ an.
Artikel von Bernard Schmid vom 19.10.2022 – wir danken!