Bild: rls
Zwei Gewerkschafter aus Berlin berichten von ihrer Reise in die Ukraine und dem Versuch, Verbindungen zwischen Beschäftigten aufzubauen
Interview: Christian Lelek
Bevor wir zu Ihrer Reise in die Ukraine kommen: Wie sind Sie eigentlich zur Gewerkschaft gekommen und warum haben Sie sich entschieden, auf dieser Ebene aktiv zu werden und zu bleiben? Das liegt ja nicht mehr unbedingt im Trend.
Enrico Wiesner (EW): Bei mir war es direkt am sogenannten Betriebetag für neue Auszubildende, als ich bei Siemens anfing. Da war ich 16. Die Funktionäre haben uns dort plausibel gemacht, dass man Gewerkschaftsmitglied sein sollte, um sich zu organisieren und eine Gegenmacht zu entwickeln, sowohl gegen die Unternehmer als auch mit Blick auf gesellschaftliche Fragen. Das war der Grund, dessentwegen ich eingetreten bin. Ich bin dann komplett durch die IG-Metall-Arbeit politisiert worden.
Hermann Nehls (HN): Ich komme aus einer Generation, in der es ein Verständnis gab: Wenn du die Gesellschaft verändern willst, dann macht man das in Betrieben und Gewerkschaft. Vor diesem Hintergrund habe ich eine Mechanikerausbildung gemacht. Anlass, in die Gewerkschaft einzutreten, war eine Auseinandersetzung bei uns im Betrieb um Bildungsurlaub. Wir haben als Ausbildungsjahrgang geschlossen darum gekämpft, dass wir diesen Bildungsurlaub in Anspruch nehmen können. Von meinem Ausbildungsjahrgang sind dann viele in die Gewerkschaft eingetreten.
Wie haben Sie sich dann kennengelernt und wie kam es zu der Reise in die Ukraine?
HN: Kennengelernt haben wir uns beim Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin, als ich einen Austausch nach Ungarn organisierte und Enrico teilnahm, weil Arbeitsplätze von Siemens dorthin verlagert werden sollten.
Ich arbeite bei einer Initiative gewerkschaftlicher Solidarität mit ukrainischen Gewerkschaften mit, die wir als Gewerkschafter von unten entwickelt haben, weil wir gesehen haben, dass es zu wenig gewerkschaftliche Initiativen gibt, die konkret darauf abzielen, humanitäre Hilfe zu leisten. Mit den Fragen »Wie ist die Lage der Beschäftigten in der Ukraine, was heißt Neoliberalisierung der Arbeitsbeziehungen unter Kriegsbedingungen?« haben wir gedacht, wir fahren hin, um persönliche Kontakte aufzubauen und von da aus weiter zu überlegen, wie wir das Thema gewerkschaftliche Solidarität hier verankern können.
EW: In meinem Freundes- und Arbeitskreis gab es sehr viele emotionale Debatten zur Ukraine, aber im luftleeren Raum, weil man nicht mit Betroffenen gesprochen hat. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, Solidarität zu üben, ohne Waffen zu liefern oder das als ein Thema am Rande zu halten. Im Endeffekt geht es um die Menschen, und darum zu erfahren, was die Ukrainer sich wünschen – und zwar mit den bestehenden Bewegungen und Organisationen.
Auf der Suche nach Antworten sind Sie also die Reise angetreten. Wer war Teil der Gruppe und wie lief der Aufenthalt ab?
HN: Vorausgegangen war eine ziemlich aufwendige Vorbereitung. Unser Interesse war, wirklich Leute aus Betrieben zusammenzubringen. Letztlich war Enrico aber der einzige, der richtig betrieblich verankert ist. Insgesamt waren wir zu fünft aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf eigene Faust unterwegs. Unsere erste Anlaufstelle war eine unabhängige Eisenbahnergewerkschaft in Kiew, zu der wir schon Kontakte hatten. Unser zweiter Kontakt war das Krankenhauspersonal in Krywyj Rih. Das ist auch eine kleine unabhängige Gewerkschaft. Das waren die Ausgangspunkte, von denen aus sich das Programm dann fast organisch erweitert hat. Wir hatten keine Berührungsängste. Unser Interesse war ja, so viele Informationen wie möglich über die Lage der Beschäftigten zu bekommen, und ein differenziertes Bild. Wir waren also in Kiew und einen Tag in Krywyj Rih.
Welche Erfahrungen haben Sie auf der ersten Station in Kiew mitgenommen?
HN: Eines der ersten Gespräche, das wir hatten, war mit der Bildungsgewerkschaft. Mich hatte gewundert, dass der Vorsitzende von fast 700 000 Mitgliedern sich mit einer fünfköpfigen Delegation trifft. Erst im Gespräch wurde mir klar, was da abging. 2022 sind unheimlich viele Delegationen gekommen, um sich zu informieren, um zu gucken, wie man Hilfslieferungen organisieren kann. In diesem Jahr waren wir die erste Delegation, und das hat den Vorsitzenden unheimlich gefreut und erfahrbar gemacht, welche Bedeutung allein moralische Unterstützung hat.
EW: Es wurde schnell klar, dass der Krieg über allem steht, er ist omnipräsent. Es gibt die Wehrpflicht. Jeder 18-Jährige muss zur Armee, es sei denn sein Job ist kriegswichtig.
Haben Sie Erfahrungen gemacht, die Parallelen zwischen Beschäftigten in Deutschland und der Ukraine erkennen lassen?
HN: In Kiew haben wir uns unter anderem mit der landesweiten Initiative #BelikeNina (Sei wie Nina) getroffen, die für die Interessen des Krankenhauspersonals kämpft. Nina Kozlovska ist eine Krankenschwester, die 2019 auf Facebook einmal beschrieben hat, wie ihre Arbeitsbedingungen sind und dass sie nicht mehr kann. Daraus hat sich eine Initiative entwickelt, die heute Vertretungsstrukturen in allen Krankenhäusern in der Ukraine hat und dabei ist, mit 80 000 Mitgliedern eine Gewerkschaft zu gründen. Es gibt eine offizielle Gesundheitsgewerkschaft vom Dachverband FPU, die eigentlich die Aufgabe hätte, genau solche Situationen aufzunehmen und die Interessen des Krankenhauspersonals zu vertreten. Doch ihr wird vorgeworfen, sie vertrete hauptsächlich die Interessen der Ärzte.
EW: Das zeigt, dass es nicht reicht, was die ukrainischen Gewerkschaften tun. Und was will die neue Gewerkschaft erreichen? Arbeitnehmerrechte durchsetzen. Sie haben uns gesagt, ähnlich wie bei uns gebe es eine zu dünne Personaldecke, hohe Arbeitsbelastung, schlechte Materialien, schlecht ausgerüstete Infrastruktur.
Neben Kiew haben Sie auch die Stadt Krywyj Rih besucht. Wen haben Sie dort getroffen?
HN: Krywyj Rih liegt ziemlich weit im Südosten, 400 Kilometer von der Front. Wir haben uns dort mit zwei Assistenzärzten getroffen. Auch sie haben gesagt, die offizielle Gewerkschaft kümmere sich nicht wirklich. Sie haben alle möglichen Initiativen unternommen, um Gelder zu kriegen, um zusätzliche Medikamente und Verbandsmaterial zu kaufen. Auch sie haben eine kleine unabhängige Gewerkschaft an ihrem Krankenhaus gegründet.
EW: Sie erzählten uns, dass sie 250 Euro im Monat verdienten. Das sind 1,30 Euro in der Stunde. Das sind die niedrigsten Löhne in ganz Europa.
Nach den Ärzten haben Sie Beschäftigte des großen Stahlwerks des indischen Konzerns Arcelor Mittal getroffen.
HN: Das hat sich ganz kurzfristig ergeben. Die Gewerkschaftsvorsitzende dort erzählte uns: »3000 Kollegen aus unserem Betrieb kämpfen an der Front, und zu unseren Aufgaben gehört es, diese Kollegen auszustatten mit notwendigen Materialien.« Die Beschäftigten haben uns aber auch damit konfrontiert, dass sie eine zugespitzte betriebliche Auseinandersetzung haben. Der landesweite Kollektivvertrag, der umfassende Schutzbestimmungen und Arbeitszeitregelungen enthält, soll geschwächt werden. Das Werk selbst hatte vor dem Krieg 25 000 Beschäftigte. Jetzt sind es noch 10 000. Aber nicht weil das Werk zerstört wurde. Es kann nicht mehr liefern, weil das Schwarze Meer als Haupthandelsroute wegfällt.
EW: Und die übrigen Beschäftigten sitzen jetzt bezahlt mit zwei Dritteln des Lohns zu Hause. Das ist in einer betrieblichen Vereinbarung geregelt. Die Leute vor Ort gingen davon aus, dass auch diese geändert werden soll. Und das vor dem Hintergrund des Streikverbots in der Ukraine. Diese Geschichten müssen erzählt, verbreitet und Protest muss dagegen organisiert werden, damit das aufhört.
Sie haben die Begegnungen und die Erlebnisse wiedergegeben. Und gesagt, dass es Ihnen zunächst um die direkte Erfahrung, das Sammeln von Wissen ging. Warum aber fiel Ihre Wahl auf den Kriegsschauplatz Ukraine?
HN: Ich war in den 80er und 90er Jahren im Rahmen von Austauschprogrammen öfters in Kiew gewesen. Deswegen war mir die Region vertraut.
Enrico hat gesagt, die Ukraine habe die niedrigsten Löhne in Europa. Und gerade deswegen beheimatet sie wichtige Zulieferindustrie. Kabelbäume für Autos werden dort gebaut. Deutsche und niederländische Agrarunternehmen haben die Ukraine, was Arbeitskräfte angeht, ausgenutzt.
Und die Lage hat sich verschärft. Die Gewerkschaften in der Ukraine stehen jetzt nochmals unter besonderem Druck. Sie sind zum einen konfrontiert mit der Kriegssituation. Die Bildungsgewerkschaft hat uns erzählt, dass über 3000 Schulen zerstört sind. Sie müssen Online-Unterricht organisieren – für Gewerkschaften eine Mammutaufgabe. Zum anderen müssen sie sich aber auch zur Wehr setzen gegen die Selenskyj-Regierung, die alles dafür tut, Arbeitnehmerrechte abzubauen, gerade die genannten Kollektivverträge. Die Bedingungen in der ganzen Arbeitswelt haben sich verschlechtert. Gerade jetzt sind Gewerkschaften wichtig, die dagegenhalten.
EW: Also, vor der Reise war für mich ganz klar: Es ist Krieg in Europa und es ist ein großer Krieg. Der ist verdammt nah. Das kann man nicht ignorieren. Ohne direktes Wissen von Beschäftigten kann ich mich in meiner betrieblichen Funktion gar nicht dazu positionieren. Insofern war es für mich eine Wissensreise, eine Erfahrungsreise. All diese Problemen, die gewachsene Korruption, der Krieg, der verletzte Stolz auf russischer Seite, das sind Dinge, über die kann man sich super am Stammtisch in Deutschland unterhalten und man bewirkt gar nichts. Oder man fährt in die Ukraine und unterhält sich mit den Leuten.
Gibt es Ideen, was mit dem neuen Wissen und den Erfahrungen, den neuen Kontakten passieren soll?
EW: Statt über Grenzverläufe und Stellungskriege wollen wir die persönlichen Geschichten erzählen und ein Interesse dafür wecken: niedrigschwellige und in den Organisationen eingebettete Austausche. Das wurde auch von einer Gewerkschaftsverantwortlichen von Arcelor Mittal geteilt. Eine Idee: fünf Jugendliche aus der Ukraine mit fünf Jugendlichen aus Deutschland, fünf Leitfragen, anschließend Diskussionen über Korruption oder Hilfe zur Selbsthilfe und darüber, was die Gruppen voneinander lernen können. Und das bestenfalls verstetigen.
Den Vertrauenskörperleiter von Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt habe ich persönlich getroffen. Er hat gesagt, das sei eine beeindruckende Geschichte. Und wenn man das weiterdenke, könnten sie das nutzen. Sie haben Fachkräftemangel in Eisenhüttenstadt, trotz Viertagewoche. Wenn sie Ukrainer besser und gezielter ausbilden, können sie Verantwortungsübernahme mit der Lösung ihrer Probleme verknüpfen. Da lassen sich Interessen verbinden. Und natürlich wollen wir Wege finden, wie Beschäftigte hier den Kampf für den Erhalt dieses ukrainischen Kollektivvertrags unterstützen können. Wir wollen auch nochmals schauen: Welche anderen vernetzten Unternehmen gibt es? Welche Firmen stellen die Kabelbäume her? In welchem deutschen Werk werden sie verbaut? Gibt es in diesem betreffenden Werk jemanden aus der Jugend, der Lust auf so einen Austausch hat?
Und Geld – wir haben bisher 13 000 Euro gespendet – soll weiterhin an die richtigen Organisationen fließen.
Haben Sie mit den Leuten und den Organisationen, die Sie getroffen haben, selbst schon weitere Verabredungen getroffen?
HN: Was #BelikeNina angeht: Da sind wir im Gespräch, dass Leute herkommen und berichten. Die Verbindung mit den Eisenbahnern läuft weiter, um Beratungsstrukturen für arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen aufzubauen. Wir bleiben auch an dem Thema Ausbildung dran. Es gab zudem ein Rieseninteresse daran, wie wir gewerkschaftliche aktivierende Jugendarbeit organisieren.
Und die Menschen, die Sie kennengelernt haben, welche Wünsche haben sie geäußert?
EW: Der Vorsitzende des gewerkschaftlichen Dachverbandes FPU hat konkret eine Spende über 500 Euro der dänischen Gewerkschaften als große Hilfe bezeichnet: »Das war gelebte Solidarität.« Er hat aber auch die Bitte geäußert: »Wenn ihr in Deutschland darüber redet, sprecht euch auch für die Waffenlieferungen aus. Wir wollen diesen Feind da besiegen.«
HN: Aber ich habe dazu klar gesagt, dass ich dagegen bin. Das wurde akzeptiert, weil das einfach eine völlig andere Ausgangslage ist. Hier führt das zu einer Militarisierung der Gesellschaft. Was Wünsche angeht: Wir haben konkrete Projekte besprochen, unter anderem wie wir bei der Ausbildung von Arbeitsrechtler*innen unterstützen können, die widerständige Kolleg*innen wie die Krankenschwestern in Arbeitskämpfen vor Gericht unterstützen.
Angenommen, ich bin einer Ihrer Kollegen. Was könnte mich überzeugen, mich für die Interessen der Beschäftigten in der Ukraine einzusetzen?
EW: Die Angleichung der Lebensstandards ist ein Selbstzweck, und zwar ein guter Selbstzweck. Du wirst immer den Verlagerungsdruck haben, solange die Arbeitsbedingungen irgendwo ein bisschen schlechter sind. Es ist klar, dass es meinen Arbeitsplatz nicht sicherer macht, wenn die Arbeitsbedingungen in derselben Firma 600 Kilometer Luftlinie von hier, die dasselbe Produkt herstellt, viel schlechter sind.
HN: Arcelor Mittal ist einer der größten Investoren in der Ukraine. Das wirft genau die Frage auf, zu welchen Bedingungen da gearbeitet wird. Wie kannst du durch die Unterstützung gewerkschaftlicher Arbeit in den Betrieben dafür sorgen, dass Dumpingbedingungen da nicht Einzug halten?
Organisiert wurde der Ukraine-Besuch von der Initiative Internationale Solidarität, finanziert von der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Am 4.12. findet um 19 Uhr eine Online-Infoveranstaltung zur Reise statt. Die Teilnahme ist über folgenden Link möglich:

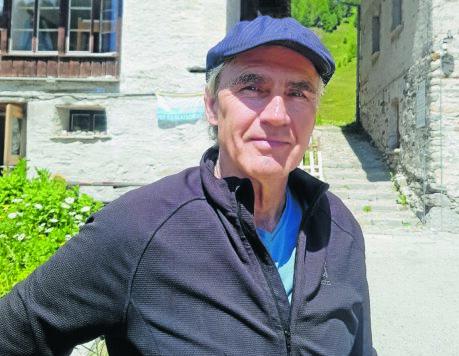
Enrico Wiesner arbeitet bei Siemens Energy, ist dort im Betriebsrat und Vertrauensleutesprecher. Zudem ist er Mitglied im Arbeitskreis Internationalismus (AKI) der IG Metall Berlin und in der Linken Neukölln. Hermann Nehls war als Mechaniker im Personalrat und Auszubildendenvertreter, beim DGB Gewerkschaftssekretär. Heute ist er berentet und aktiv im Verein Internationale Solidarität, im AKI und in der Linken Neukölln.
Erstveröffentlicht in nd vom 2.12.23
https://www.nd-aktuell.de/
Wir danken dem nd und unseren Kollegen für das Publikationsrecht.



