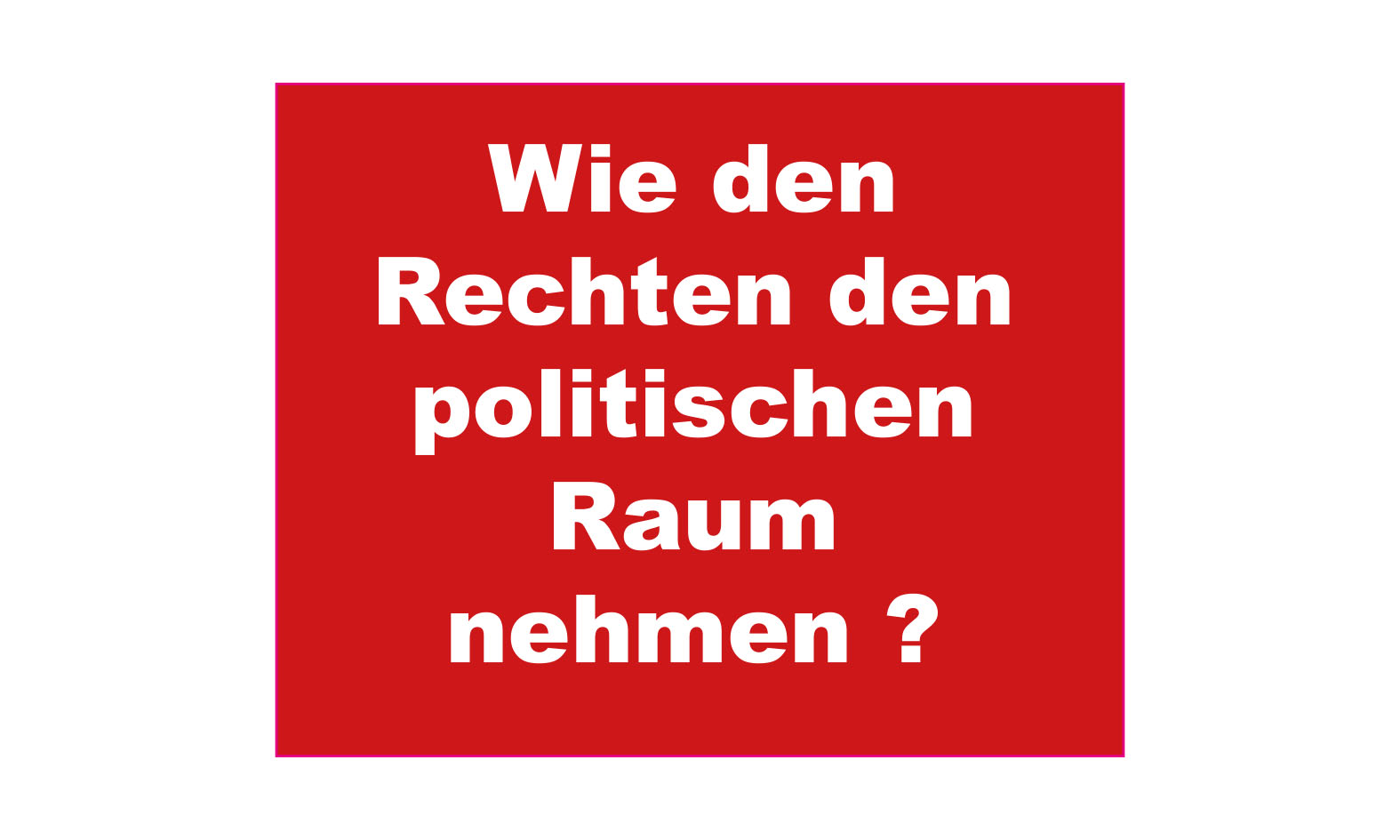Linke Gewerkschafter kritisieren Passus im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
Von Peter Nowak
Bild: Benjamin Ruß. Bearbeitetes Screenshot Youtube-Video
Als »schwieriges Ergebnis in schwierigen Zeiten« hat der Verdi-Bundesvorstand das Ergebnis der Tarifrunde im öffentlichen Dienst für Bund und Kommunen bezeichnet. Wesentlich kritischer äußerte sich das Netzwerk für eine kämpferische und demokratische Verdi. »Nein zu Reallohnverlust, 27 Monaten Laufzeit und Einstieg in die 24-Stunden-Woche«, heißt es in einer Stellungnahme.
Die Gruppe rügt auch einen Passus im künftigen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), der auch bei linken Gewerkschafter*innen bislang wenig Beachtung findet, obwohl er eine höchst politische Dimension hat. Dieser macht bei Auszubildenden und Studierenden »Verfassungstreue« zur Bedingung für eine Übernahme ins Arbeitsverhältnis. Wörtlich heißt es dort: »Voraussetzung für die Übernahme ist, dass Auszubildende und dual Studierende des Bundes und anderer Arbeitgeber, in deren Aufgabenbereichen auch hoheitliche Tätigkeiten wahrgenommen werden, sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen.« Es dürfe »während der gesamten Ausbildungsdauer/Studiendauer kein Zweifel am Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bestehen«.
Das ist eine deutliche Verschärfung gegenüber der Regelung im auslaufenden TVÖD. Dort lautet der entsprechende Passus: »Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung bei dienstlichem beziehungsweise betrieblichem Bedarf im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen, sofern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen.«
Von einem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung (FDGO) war bisher nicht die Rede. Dieser Begriff wurde in den 70er und 80er Jahren in Westdeutschland missbraucht, indem mit dem sogenannten Radikalenerlass die Überprüfung von Lehramtsanwärter*innen und vielen anderen Beschäftigten begründet wurde. Dies führte zur Bespitzelung von rund 3,5 Millionen Bewerber*innen und Beschäftigten im öffentlichen Dienst durch den Verfassungsschutz. In der Folge kam es zu Berufsverbotsverfahren gegen 11 000 Personen. 2250 von ihnen wurde tatsächlich die Einstellung verweigert, 256 Beamt*innen wurden entlassen.
Das Netzwerk für eine kämpferische und demokratische Verdi sieht in der neuen Regelung im TVÖD eine »Drohung für alle politisch interessierten und aktiven jungen Menschen«. Zuletzt habe man gesehen, wie etwa das »Liken« eines Posts in den sozialen Medien, in dem das Vorgehen Israels in Gaza verurteilt wird, ausgereicht habe, »um eine öffentliche Kampagne gegen die Präsidentin der Technischen Universität Berlin auszulösen«. Das zeige, »welche einschränkende Wirkung eine solche tarifvertragliche Klausel haben könnte«.
Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, fordert auf X immer wieder Konsequenzen für vermeintliches Fehlverhalten von Personen im öffentlichen Dienst. 1999, damals noch Grünen-Bundestagsabgeordneter, hatte er die »Formel von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung als Kampfbegriff zur Ausgrenzung missliebiger Kritiker« bezeichnet.
Derzeit warnen auch Gewerkschaften vor einer Rückkehr von Radikalenerlass und Berufsverboten, insbesondere auf Länderebene. So kritisiert der Hamburger DGB die Pläne des rot-grünen Senats, wieder die Regelanfrage beim Verfassungsschutz für alle Bewerber*innen im öffentlichen Dienst einzuführen.
In Bayern wurden unter anderem die Berufsverbote gegen die Lehramtsanwärterin Lisa Poettinger und gegen den Geoinformatiker Benjamin Ruß mit Paragraf 3 des Tarifvertrags der Länder (TVL) begründet, der weitgehend mit der neuen Passage im TVÖD übereinstimmt. Ruß berichtete kürzlich auf einer Veranstaltung der Hamburger Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) von seinen Erfahrungen. Ihm wurde eine schon zugesagte Stelle an der Technischen Universität München verweigert, weil er unter anderem Mitglied des Studierendenverbands Die Linke.SDS und der Gefangenensolidaritätsorganisation Rote Hilfe ist. Das Münchner Arbeitsgericht wies nach einer zweijährigen gerichtlichen Auseinandersetzung die Klage von Ruß gegen die Nichteinstellung zurück.
Erstveröffentlicht im nd v. 8.4. 2025
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1190425.verfassungstreuecheck-im-oeffentlichen-dienst-pflicht-zur-verfassungstreue-einfallstor-fuer-repressalien.html
Wir danken für das Publikationsrecht.