von Fabrizio Burattini
Die CGIL in Italien hat eine mutige politische Initiative gestartet, um im Prozess zurückgehenden gewerkschaftlichen Einflusses erneut in die Offensive zu gehen. Das von der Gewerkschaft auf den Weg gebrachte Referendum scheiterte, möglicherweise an bestimmten italienischen Gegebenheiten, die der Artikel versucht zu erklären. Das spricht jedoch nicht dafür, dass eine solche Initiative scheitern musste. Es wäre ein Schritt nach vorn, wenn die IG Metall als deutsche Schwesterorganisation den Mut für einen solchen Schritt finden könnte, um aus einer vergleichbaren Situation neue Stärke zu entwickeln. Geworben für das Referendum unter ihren italienischen Mitgliedern hat sie schon. (Jochen Gester)
https://www.igmetall-berlin.de/aktuelles/meldung/ig-metall-berlin-ruft-ihre-italienischstaemmigen-mitglieder-zur-teilnahme-am-cgil-referendum-auf-versione-italiana-qui-sotto
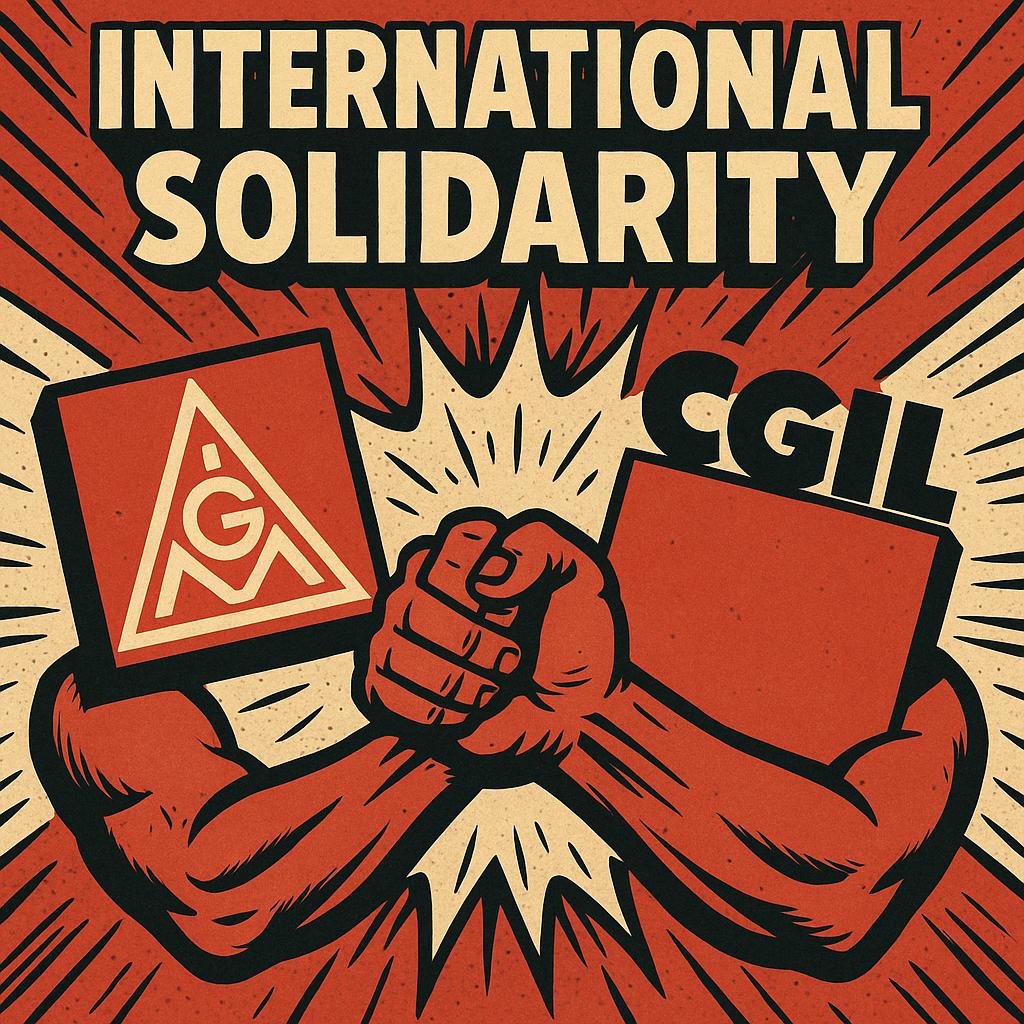
Bild: CGIL
Die italienische Gewerkschaft hat fünf Referenden über die Arbeitsbedingungen angestrengt. Weil nur 30 Prozent sich an der Abstimmung beteiligt haben, wurden sie verloren.
Die CGIL ist mit über fünf Millionen Mitgliedern die älteste und größte Gewerkschaft in Italien. In den letzten Jahren hat sie trotz ihrer radikalen Führung – Maurizio Landini, ihr Generalsekretär seit 2019, war zuvor Vorsitzender der Metallarbeitergewerkschaft FIOM, die historisch gesehen die kämpferischste ist – eine äußerst vorsichtige und gemäßigte Politik betrieben. Sie hat die Demontage eines Großteils aller gewerkschaftlichen und sozialen Errungenschaften, die die Arbeiterbewegung in den Kämpfen der Nachkriegszeit und der 1960er und 1970er Jahre durchsetzen konnte, miterlebt ohne jemals den Versuch zu unternehmen, eine echte Widerstandsbewegung zu schaffen.
Ihren letzten großen Arbeitskampf führte die CGIL, damals unter der Leitung des gemäßigten Sergio Cofferati, in den Jahren 2001-2002 für die Verteidigung von Artikel 18 des Arbeiterstatuts, den die damalige Regierung Berlusconi abschaffen wollte. Das Arbeiterstatut stammt von 1970 und stellte eine bedeutende Verbesserung der Arbeiterrechte dar. Selbst die Übernahme der Regierung durch die Fratelli d’Italia, die neofaschistische Partei von Giorgia Meloni, im September 2022 änderte nichts an der moderaten, auf Dialog ausgerichteten Haltung der CGIL, nun unter der Leitung von Landini. So sehr sogar, dass die CGIL-Führung im März 2023 – trotz Protesten aus dem linken Flügel der Gewerkschaft – die rechtsextreme Ministerpräsidentin als Rednerin zum 19. Gewerkschaftskongress einlud, in der Hoffnung, sie für eine Politik der Konsultation gewinnen zu können. Doch das Gegenteil geschah: Ungeachtet der „sozialen“ Demagogie, die die Partei mit den faschistischen Wurzeln betrieb, solange sie in der Opposition war, schwenkte die Regierung Meloni sofort auf eine volks- und gewerkschaftsfeindliche Linie um, die sich in Dutzenden von Gegenreformen und Haushaltskürzungen niederschlug.
Daraufhin änderte die CGIL ihren Kurs und begann, oppositionelle Initiativen zu ergreifen – selbst auf die Gefahr hin, die gemeinsame Linie mit der zweitgrößten Gewerkschaft CISL zu verlassen. Nur die drittgrößte Gewerkschaft, die UIL, die unter ihrem neuen Vorsitzenden Pierpaolo Bombardieri ebenfalls eine gewisse Linkswende vollzogen hatte, blieb noch im Bündnis. Ende 2023 und 2024 wurden landesweite Demonstrationen und einige Streiks organisiert, um der „radikalen Wende“ Nachdruck zu verleihen.
Doch nach über 20 Jahren Lähmung der Bewegung und zahlreichen Niederlagen war es nicht leicht, den Massenkampf wieder in Gang zu bringen. Die Arbeitswelt war durch die neoliberale Politik schrecklich zersplittert worden, ein großer Teil der betrieblichen Vorhut war nicht mehr aktiv oder aus Altersgründen aus dem Berufsleben ausgeschieden. Der gigantische Gewerkschaftsapparat (allein die CGIL hat über 15.000 Hauptamtliche) hatte sich auf eine konzertierte Politik des individuellen Schutzes eingestellt.
So entschied sich Maurizio Landini gegen den Widerstand eines Großteils des ihn umgebenden Apparats für eine Mobilisierung mit Hilfe eines Referendums. Die italienische Verfassung kennt das „aufhebende Referendum“ – es erlaubt, nach Sammlung von mindestens 500.000 Unterschriften (tatsächlich hat die CGIL mehr als eine Million Unterschriften gesammelt), die Wahlberechtigten zu fragen, ob bestimmte staatliche Gesetze aufgehoben werden sollen oder nicht.
Im Gegensatz zur Mobilisierung auf der Straße und erst recht zum Massenstreik war die Unterschriftensammlung für einen so umfassend präsenten und organisierten Apparat wie den der CGIL kein großes Hindernis. Die CGIL schlägt den Wähler:innen also die Aufhebung von vier Gesetzen vor, über die diese am 8. und 9. Juni entschieden haben. Die Partei „+Europa“, eine liberale Organisation, Erbin der Radikalen Partei von Marco Pannella, hat sich mit einem fünften Referendum angeschlossen.
Der Inhalt der Referenden
Die vier Referenden der CGIL zielen darauf ab, einige der perversesten und volksfeindlichsten Gesetze der letzten Jahrzehnte aufzuheben.
Das erste ist politisch am symbolträchtigsten, denn es will die Abschaffung von Artikel 18 des Arbeiterstatuts aus dem Jahr 2015 wieder rückgängig machen – die Abschaffung war damals übrigens von der Demokratischen Partei unter Matteo Renzi durchgesetzt worden. Überwiegt das Ja im Referendum, würde der Arbeitgeber also wieder verpflichtet, einen zu Unrecht entlassenen Arbeitnehmer auf seinem alten Arbeitsplatz weiter zu beschäftigen.
Das zweite Referendum will den Schutz vor unrechtmäßigen Entlassungen in Unternehmen mit weniger als 16 Beschäftigten verbessern – für sie gilt Artikel 18 des Arbeiterstatuts nicht.
Das dritte soll Unternehmen verpflichten, feste und keine befristeten Arbeitsverträge abzuschließen, es sei denn, es gibt dafür objektive Gründe (z. B. bei Saisonverträgen).
Das vierte Referendum macht das auftraggebende Unternehmen bei Unfall oder Todesfall am Arbeitsplatz mitverantwortlich. In Italien werden jedes Jahr etwa 500.000 Unfälle am Arbeitsplatz gemeldet (dabei gibt es noch Tausende von nicht gemeldeten Unfällen in Unternehmen, die Schwarzarbeiter beschäftigen) und etwa 1.000 Todesfälle. Ein großer Teil dieser Unfälle ist auf kleine und kleinste Subunternehmen zurückzuführen, die oft über Nacht verschwinden oder auf jeden Fall nicht in der Lage sind, für die Entschädigung der verletzten Person oder der Familie des Todesopfers aufzukommen.
Das von „+Europa“ vorgeschlagene Referendum befasst sich mit einem ganz anderen, aber ebenso wichtigen Thema: Die Anzahl der Jahre, die ein nicht-italienischer Staatsbürger rechtmäßig im Land verbracht haben muss, um die italienische Staatsbürgerschaft zu beantragen, soll von 10 auf 5 Jahre reduziert und die Möglichkeit geschaffen werden, die Staatsbürgerschaft an die minderjährigen Söhne und Töchter weiterzugeben. Fast drei Millionen Menschen, die in Italien geboren und aufgewachsen sind und dort seit Jahren arbeiten oder studieren, würden damit Zugang zur Staatsbürgerschaft erhalten und könnten die in der Verfassung von 1948 anerkannten Rechte in vollem Umfang genießen.
Die politische Linke, sowohl die „radikale“ und außerparlamentarische Linke wie auch die institutionelle Opposition – die Allianz Verdi Sinistra (AVS), die Demokratische Partei (PD) und die Fünfsternebewegung (M5S) – wirbt für ein Ja. Dies ist nicht ganz selbstverständlich, bedenkt man, dass die ersten drei Referenden Verordnungen aufheben wollen, die 2015 von einer PD-Regierung eingeführt worden waren. Einige führende Vertreter der explizit neoliberalen Strömung dieser Partei, die aus der Kommunistischen Partei Italiens hervorgegangen ist, haben offen erklärt, dass sie mit der Entscheidung der aktuellen PD-Führung um Elly Schlein, mit Ja zu stimmen, nicht einverstanden sind.
Die größte Hürde: wählen gehen
Nicht überraschend, wenn auch absolut inkonsequent, hat sich die regierende Rechte geschlossen gegen die Referenden ausgesprochen – bedenkt man, dass die gesamte Rechte 2014-15 im Parlament gegen das Gesetz von Renzi gestimmt hat. Heute, nachdem sie jegliche „soziale“ Demagogie aufgegeben hat, aber in perfekter Übereinstimmung mit den Wünschen der Arbeitgeberverbände, insbesondere der Confindustria, setzt sie alles daran, sie scheitern zu lassen.
Ein Referendum zur Abschaffung eines Gesetzes gilt nur dann als erfolgreich, wenn mindestens 50 Prozent + 1 der Wahlberechtigten an der Abstimmung teilgenommen haben und die Mehrheit mit Ja gestimmt hat. Alle Gegner des Referendums verlegen sich deshalb darauf, die Wähler:innen dazu zu bewegen, nicht zur Wahl zu gehen.
In Italien wurden seit 1974 72 abrogative Referenden durchgeführt. Einige davon hatten historische Bedeutung. So das Referendum von 1974, bei dem 60 Prozent der Wähler:innen die Aufhebung des Scheidungsgesetzes von 1970 ablehnten, oder das von 1981, das mit 88 Prozent Neinstimmen die Aufhebung des Abtreibungsgesetzes verhinderte. Oder das von 1987, das mit 80 Prozent Ja-Stimmen die Abschaltung der Kernkraftwerke bewirkte. Oder das von 2011, das mit 95 Prozent Ja-Stimmen die Möglichkeit der Privatisierung der öffentlichen Wasserversorgung aufhob.
Das Referendum von 2011 war jedoch das letzte, an der eine Mehrheit der Wähler:innen teilnahm. Seit den 1990er Jahren und dann immer systematischer haben Parteien, wenn sie gegen Referenden waren, dazu aufgerufen, sich der Stimme zu enthalten statt mit Nein zu stimmen. 1991 forderte der damalige sozialistische Ministerpräsident Bettino Craxi die Wähler auf, „ans Meer zu fahren“. Das haben diesmal zahlreiche Rechte wieder getan.
Die Rechte setzt auf die ständige Verschärfung der Krise der liberalen Demokratie, die dazu führt, dass immer größere Teile der Wählerschaft nicht zur Wahl gehen – schon gar nicht bei Volksabstimmungen. An den Parlamentswahlen 2022 beteiligten sich nur 64 Prozent der Wählerschaft, an den Europawahlen 2024 nur 48 Prozent. Die extremen Schwierigkeiten konnten uns nicht davon abhalten, am 8. und 9. Juni eine Kampagne für fünfmal Ja zu führen.
Fabrizio Burattini ist Leitungsmitglied von Sinistra Anticapitalista, Gewerkschaftsaktivist and verantwortlich für die Webseite refrattario.link
Erstveröffentlicht auf soz-online
https://www.sozonline.de/2025/06/union-goes-politics/
Wir danken für das Publikationsrecht.




