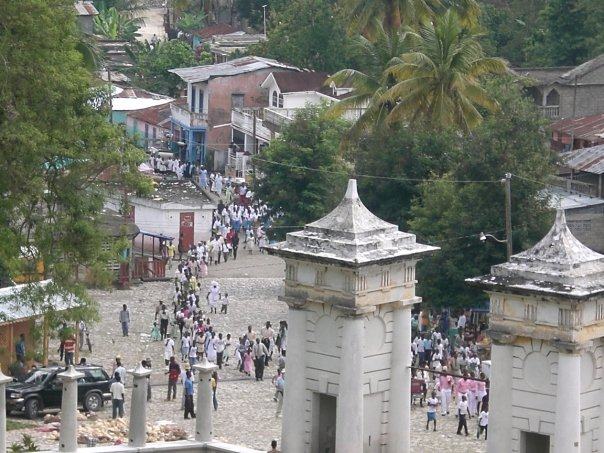Die Nato schraubt wegen der angeblichen russischen Bedrohung die “minimal benötigten Fähigkeiten” in die Höhe. Die deutschen Militärausgaben müssten auf 3 Prozent vom BIP, die Bundeswehr um mindestens 60.000 zusätzliche Soldaten wachsen.
Von Florian Rötzer
Bild: Raptor F22. Wikimedia.
Die Angst der Deutschen vor einem Krieg, an dem Deutschland beteiligt ist, scheint trotz Beschwörungen einer russischen Kriegsgefahr und Forderungen nach weiterer Aufrüstung nicht besonders hoch zu sein. Aus der jährlichen Umfrage der R+V Versicherung zu den Ängsten der Deutschen geht hervor, dass diese steigende Lebenshaltungskosten am stärksten fürchten (57%), an zweiter Stelle kommt die Überforderung des Staats durch die Zahl der Geflüchteten (56%). Politikern traut man nicht mehr sonderlich viel zu und hält sie für überfordert (49%). Die Angst vor politischem Extremismus – wohl mit Blick auf die AfD – ist stark angestiegen.
Ziemlich weit hinten, auf Platz 16, kommt die Angst vor einem Krieg (41%). Das ist zwar noch immer deutlich höher als 2021 vor dem Ukraine-Krieg (16%), aber ein leichter Rückgang gegenüber 2023 (43%) trotz zunehmenden Crescendo aus der Nato und der schwächelnden Ukraine. Auch der Angstindex, der durchschnittliche Wert aller gemessenen Ängste, ist von 45% (2023) auf 42 % gesunken.
Wenn die Kriegsgefahr so weit hinten angesiedelt ist, nach Pflege auf dem 11 Platz, Kosten durch EU-Schuldenkrise, Naturkatastrophen, Terrorismus und Klimawandel und ebenso stark wie Angst vor Schadstoffen in Lebensmitteln, wundert dann doch, warum derzeit Verteidigungsminister Boris Pistorius bei weitem der beliebteste Politiker ist.
Dabei scheint seine Leistung im militärischen Bereich zur Ertüchtigung der Deutschen nicht entscheidend zu sein, auch wenn er dank Sondervermögen viele Milliarden in Anschaffungen steckte, in Litauen der Aufbau der 4800 Frau/Mann starken Panzerbrigade 45 vorantreibt und versucht, ohne Einführung eines Wehrdienstes durch Nudging das Personal der Bundeswehr aufzustocken. An letzterem hakt es besonders, seit Jahren soll das Bundeswehrpersonal von 180.000 auf mehr als 200.000 aufgestockt werden, aber bislang kann man gerade die Zahl so halten.
Der neue Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat bei Amtsantritt seine zwei wenig überraschenden Prioritäten herausgestellt: Die Nato-Staaten müssen weiter aufrüsten und die Rüstungsindustrie ausbauen, weil sie sich im Konflikt mit Russland befinden, und die Ukraine muss weiter bis zum Sieg unterstützt werden (to ensure that Ukraine prevails), was er durch seinen Besuch in Kiew deutlich machte. Die indirekten und direkten Kosten des Ukraine-Kriegs hatten wir vor kurzem behandelt, darin stecken auch die Gelder etwa aus dem Sondervermögen, die in die Aufrüstung der Bundeswehr gesteckt wurden und werden. Schon 2014 hatte nach dem Sturz der Janikowitsch-Regierung durch Radikale der Maidan-Bewegung, der Abspaltung der Volksrepubliken und der “Antiterroroperation” im Donbass und der Annexion der Krim durch Russland die Nato beschlossen, dass die Mitgliedsländer mindestens 2 Prozent des BIP für das Militär ausgeben müssen.
Deutschland hat erstmals 2024 die 2-Prozent-Schwelle überschritten und soll mit über 90 Milliarden Euro nach Nato-Angaben 2,12 Prozent des BIP in die Rüstung stecken. 2021 und 2022 waren es noch 62 Milliarden, 2023 73 Milliarden. 2024 werden also über 20 Milliarden mehr ins Militär fließen als 2023. Jetzt wurde bekannt, dass die Nato noch deutlich mehr Geld zur Aufrüstung gegen den Hauptfeind Russland fordert. Ein guter Teil kommt den Rüstungskonzernen, vor allem den amerikanischen, zugute, bei denen die Alliierten einkaufen und auch so die Stärke der USA und die Abhängigkeit von ihr mehren.
Die “minimal benötigten Fähigkeiten” der Nato
Im Frühjahr wurden den Mitgliedsländern, wie Welt berichtet, die Einsicht in die Dokumente erhalten haben will, die von den höchsten Nato-Militärs US-General Christopher Cavoli und dem französischen Admiral Pierre Vandier festgelegte, angeblich erforderliche „Gesamtheit der minimal benötigten Fähigkeiten“ (MCR oder Minimum Capability Requirements) mitgeteilt. Die Militärs wittern ihre Chancen und langen kräftig zu. 131 Kampftruppen-Brigaden seien bis 2031 erforderlich, 49 mehr, als noch 2021 veranschlagt wurde. Das wären, wenn eine Brigade um die 5000 Soldaten und Soldatinnen stark ist, stolze 245.000 mehr, um „jeden Zentimeter des alliierten Territoriums zu verteidigen“ oder auch Angriffe ausführen zu können.
Alle Länder tun sich schwer, schon jetzt die Personalstärke zu halten. Es würde bei Umsetzung die Einführung einer europaweiten Wehrpflicht erforderlich werden, was auch teuer ist, oder es müssten die Bezüge deutlich erhöht werden, um die Streitkräfte als Arbeitgeber attraktiv zu machen. Aber es kommt noch mehr, wie die Welt schreibt: „Zur Führung und Unterstützung dieser Truppen soll die Zahl der ‚Warfighting Corps‘ von sechs auf 15 steigen, die der Divisions-Hauptquartiere von 24 auf 38.“ Zu den Warfighting Corps heißt es: „a War-Fighting Corps should be capable to conduct territorial defense for NATO with up to five divisions and 120,000 troops”. Das also mal 15?
„Es muss Richtung drei Prozent gehen“
Mehr, mehr, mehr ist auch die Devise bei der Beschaffung schwerer Waffen. So soll die Zahl der bodengebundenen Flugabwehrsysteme wie Patriot (mind. 400 Millionen US-Dollar pro Stück ohne Raketen) oder Iris (140 Millionen Euro) von 293 auf 1467 steigen, schlappe 1174 mehr. Auch die Zahl der Hubschrauberverbände soll wachsen, von 90 auf 104. Beispielsweise sind beim Luftwaffengeschwader 64 der Bundeswehr 2700 Soldatinnen und Soldaten und Zivilangestellte tätig. Es verfügt über 15 H145M LUH SOF und 60 CH-53-Hubschrauber.
Deutschland soll einen Anteil von 9,28 Prozent aller Gesamtfähigkeiten leisten. Das würde heißen, 5-6 zusätzliche Kampftruppenbrigaden“ zu den jetzt bestehenden 8 und dem im Aufbau befindlichen in Litauen, einen „Warfighting Corps“ und einen weiteren Hubschrauberverband. Wie gesagt, schon die zusätzlichen Zehntausenden von Soldatinnen und Soldaten, die erforderlich wären, wird die Bundeswehr ohne Zwang nicht aufbringen können. Es könnten zusätzliche 60.000 sein. Nach dem Verteidigungsministerium gelte allerdings für die Bundesregierung „die Erfüllung der Nato-Fähigkeitsziele als nationale Priorität“.
Es liegt auf der Hand, dass dies bedeutet, deutlich mehr als 2 Prozent des BIP ins Militär jährlich zu investieren. Der SZ sagte der deutsche Nato-General Christian Badia: „Es muss Richtung drei Prozent gehen.“ 90 Milliarden seien alleine zur Erfüllung des 2-Prozent-Ziels notwendig, sagt der General.
Alternativen gibt es bei der Nato nicht zur Aufrüstung, ebenso wie bislang keinen Plan B zum Ukraine-Krieg, in dem die Ukraine siegen oder weiter kämpfen soll, was bedeutet, dass viele weitere Milliarden für Waffen- und Finanzhilfen ausgegeben werden müssen. Schon 2024 haben die Militärausgaben am Gesamthaushalt einen Anteil von 11,8 Prozent, der 2025 auf 14 Prozent wachsen soll, während die Sozialausgaben sinken sollen. Geplant ist für 2025 eine Zunahme des Verteidigungshalts von 2,5% auf 53,23 Milliarden Euro. Dazu sollen aus dem Sondervermögen 22 Milliarden kommen. Das wären dann 75 Milliarden, damit würde das 2-Prozent-Ziel wieder erreicht.
Wie lange tragen die Deutschen die Aufrüstungspolitik mit?
Der ordentliche Militärhaushalt soll 2026 und 2027 bei 53,23 Milliarden bleiben und 2028 plötzlich auf 80 Milliarden steigen, natürlich ohne zu sagen, wie die Steigerung finanziert werden soll, aber da wird es auch die Ampel nicht mehr geben. Aber auch das wird nicht reichen, wenn die Nato-Vorgaben erfüllt werden sollen. Pistorius machte schon im September klar: „Wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen.“
Neue Schulden und Einsparungen oder Steuererhöhungen wären notwendig. Die Frage ist, ob die Deutschen die alternativlose Militärpolitik auch weiter mittragen werden. Die Ampel kann es noch aussitzen, die neue Bundesregierung wird kräftig in die Beeinflussung der Bürger investieren müssen, wenn sie weiterhin an dem Militärkonzept festhalten will. Es muss also dafür gesorgt werden, dass die Menschen nicht nur hohe Angst vor einem Krieg mit Russland oder China bekommen, sondern auch glauben, dass Aufrüstung und Abschreckung die Kriegsgefahr mindern. Letzteres führt allerdings zu Kriegen, was der Ukraine-Krieg belegt.
Erstveröffentlicht im Overton Magazin v. 12.10. 2024
https://overton-magazin.de/top-story/der-ruestungswahnsinn-der-nato-trifft-noch-nicht-auf-die-kriegsangst-der-deutschen/
Wir danken für das Publikationsrecht.