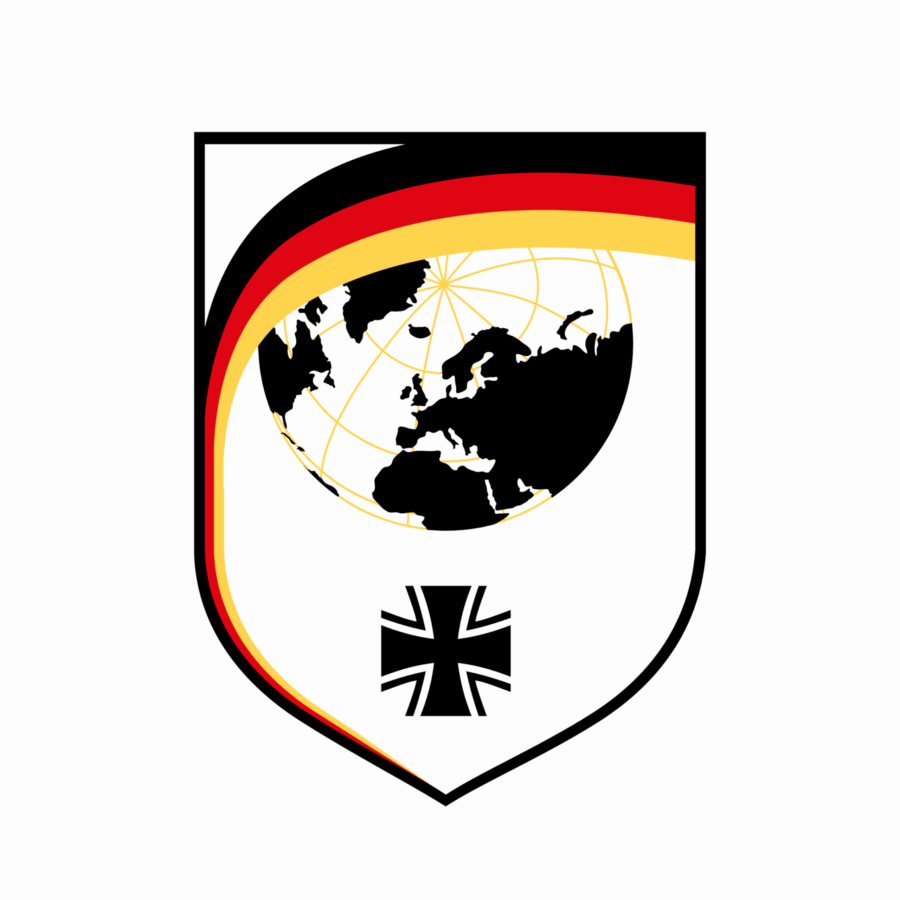Von der Armee des »Frontstaats« im Kalten Krieg über weltweite Einsätze bis zur erneuten Rüstung gegen Russland. Eine kurze Geschichte der Bundeswehr, die vor 70 Jahren gegründet wurde Von Jörg Kronauer
Jörg Kronauer schrieb an dieser Stelle zuletzt am 21. März 2025 über die Herausbildung einer transatlantischen extremen Rechten: »Braune Internationale«
Bild: bundeswehr.de
Das Eiserne Kreuz dominierte die Halle in der Ermekeilkaserne in der Bonner Südstadt, als dort am 12. November 1955 die noch junge, aufstrebende Bundesrepublik Deutschland ihre Armee erhielt. Riesig, fast fünf Meter groß, prangte es über dem Rednerpult, hinter dem sich der erste BRD-Verteidigungsminister, Theodor Blank, an die 101 Freiwilligen wandte, die an jenem Tag ihre Ernennungsurkunden erhalten würden. Die meisten von ihnen trugen stolz das Eiserne Kreuz an ihrer Uniform, das zuerst im preußischen Heer verwendet wurde und zuletzt als Ehrenzeichen der Wehrmacht diente. In ihr hatten die meisten Soldaten der »neuen Wehrmacht« gekämpft, wie die frisch gegründete Truppe vorerst noch genannt wurde; die Bezeichnung Bundeswehr kam erst einige Monate später auf. Nicht zuletzt die zwei obersten Generäle, die Generalleutnante Adolf Heusinger und Hans Speidel, hatten in der Wehrmacht Karriere gemacht, waren also durch die NS-Streitkräfte geprägt, deren Geist in der neuen Truppe allgegenwärtig war – ganz besonders in ihrer militärischen Führung.
Auf die Gründung der Bundeswehr hatten alte Wehrmachtsoffiziere bis zu zehn Jahre lang hingearbeitet. Speidel soll Konrad Adenauer schon im November 1945 eine erste Denkschrift dazu geschickt haben. Im Juni 1948 forderte er bereits unverblümt »Panzertruppen« für einen noch gar nicht gegründeten neuen deutschen Staat ein. Am 3. Dezember 1949 warb Adenauer in einer US-Zeitung erstmals öffentlich für einen militärischen Beitrag der BRD zu einer europäischen Armee. Der Beginn des Korea-Kriegs am 25. Juni 1950 brachte die Sache in Schwung. Mit Zustimmung der Alliierten erstellten vom 5. bis zum 9. Oktober 1950 15 ehemalige Wehrmachtssoldaten, zehn von ihnen Generäle und Admirale, in Himmerod in der Eifel die Himmeroder Denkschrift, eine Art Blaupause für die Schaffung bundesdeutscher Streitkräfte. Unmittelbar anschließend gründete Adenauer die Dienststelle Blank, in der unter der Leitung des CDU-Politikers und Oberleutnants a. D. Theodor Blank die Vorbereitungen für eine »neue Wehrmacht« gesteuert wurden. Am 12. November 1955 war es dann so weit.
Schon bald danach, am 2. Januar 1956, traten erste Soldaten den Dienst in den Lehreinheiten der neuen Truppe an. Ein gutes Jahr später, zum 1. April 1957, erfolgte die Einberufung der ersten Wehrpflichtigen. Die Bundeswehr wuchs, überschritt in den 1960er Jahren die Zahl von 400.000 Soldaten und erreichte ab den 1970er Jahren annähernd eine halbe Million. Ihre Aufgabe bestand darin, im Rahmen der NATO, der die Bundesrepublik seit 1955 angehörte, ihren Beitrag zu leisten, militärisch gegen die Streitkräfte der Sowjetunion respektive der Warschauer Vertragsorganisation anzutreten. Im Rahmen der sogenannten Vorneverteidigung wurden die Einheiten der Bundeswehr und anderer verbündeter Streitkräfte nahe der Grenze zur DDR und zur Tschechoslowakei stationiert, um im Kriegsfall nach Möglichkeit keine Territorien preisgeben zu müssen: keinen Quadratzentimeter des NATO-Bündnisgebiets. Die Bundesrepublik war der wichtigste »Frontstaat« des Kalten Kriegs.
Seit den 1970er Jahren war die Bundeswehr die zahlenstärkste der westeuropäischen Armeen – noch vor den Streitkräften Frankreichs und Großbritanniens. Gleichzeitig beschaffte sie in einer Welle rasanter Aufrüstung modernste Waffen. In den 1970er Jahren erhielt sie den Kampfpanzer »Leopard 2«, der als herausragendes Waffensystem galt. Zugleich konnte sie mit dem »Tornado« einen hochmodernen Kampfjet in Dienst stellen. Unterschiedliche Kriegsschiffe, Hightechpanzerabwehrwaffen und allerlei weitere Rüstungsgüter kamen hinzu. Dafür gab die Bundesrepublik viel Geld aus. Bereits in der ersten Hälfte der 1960er Jahre schoss der Anteil des bundesdeutschen Wehretats an der Wirtschaftsleistung auf weit über vier Prozent in die Höhe. In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre ging er etwas zurück und pendelte sich in den 1970ern bis in die frühen 1980er Jahre bei rund drei Prozent der Wirtschaftsleistung ein. Der Fokus der Bundeswehr lag dabei stets auf einem möglichen Krieg gegen die Sowjetunion. Weiterreichende Einsätze galten in Bonn damals noch als völlig undenkbar.
»Unangenehme Aufgaben«
Ein Wandel, der diese Beschränkung schrittweise aufheben sollte, begann recht vorsichtig Ende der 1980er Jahre: die Orientierung in Richtung Auslandseinsätze. Frühe Anfragen der Vereinigten Staaten, ob Bonn nicht bereit sei, die Bundeswehr ins Ausland zu entsenden, wurden Anfang der 1980er Jahre von der Bundesregierung noch zurückgewiesen. In einem Beschluss des Bundessicherheitsrats vom 3. November 1982 etwa hieß es, eine Beteiligung der Truppe »an einer internationalen Streitmacht im Persischen Golf« komme gar nicht in Frage. Im September 1987 verlangte die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag erstmals, wolle die Bundesrepublik international als »Gleiche unter Gleichen« auftreten, müsse sie auch militärisch »unangenehme Aufgaben« übernehmen. Das Bundesverteidigungsministerium ließ nur wenig später, in einem auf den 16. Oktober 1987 datierten Gutachten, »Einsätze im Rahmen nationaler maritimer Krisenoperationen außerhalb des NATO-Vertragsgebietes« prüfen.
Ein erster praktischer Durchbruch erfolgte bald, wenngleich nicht im Rahmen maritimer Operationen und auch noch nicht mit Soldaten. Die allmähliche Verringerung der Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion erleichterte es dem UN-Sicherheitsrat ab 1988, sogenannte Peacekeeping-Missionen zu entsenden. Von 1945 bis 1987 hatte es nur 13 UN-Blauhelmeinsätze gegeben. Von 1988 bis 1993 jedoch schnellte die Anzahl neuer Blauhelmeinsätze auf 20 nach oben. Die Zahl der beteiligten Soldaten und Polizisten stieg entsprechend von gerade einmal 11.100 Anfang 1988 auf mehr als 78.400 im Juli 1993. Der in raschem Tempo steigende Bedarf erleichterte es der Bundesrepublik, die zuvor im europäischen Ausland noch starken Bedenken gegenüber einer Entsendung bewaffneten deutschen Personals ins Ausland zu überwinden. Erstmals konnte Bonn im September 1989 50 Beamte des Bundesgrenzschutzes unter der Flagge der UNO nach Namibia schicken. Damit brach die Bundesrepublik ein jahrzehntealtes Tabu.
Dann kam das Jahr 1990; die BRD verleibte sich die DDR ein – und die Bundeswehr war eigentlich, sollte man denken, vorläufig mit anderem beschäftigt. Denn mit der Übernahme der DDR übernahm die BRD auch die Nationale Volksarmee, die am 3. Oktober 1990 noch rund 90.000 Soldaten, etwa 39.000 Wehrdienstleistende und ungefähr 48.000 zivile Beschäftigte hatte und nun in die Bundeswehr eingegliedert wurde. Diese wuchs dadurch – und sie behielt einen Teil der NVA-Soldaten, insgesamt rund 10.800, in ihren Reihen. Die Liegenschaften der DDR-Streitkräfte übernahm die Bundeswehr komplett, außerdem deren Waffen, die sie allerdings zum Großteil ins Ausland verkaufte oder anderweitig entsorgte.
All das hielt Bonn nicht davon ab, nun mit noch gesteigertem Tempo die Auslandseinsätze nicht bloß des Bundesgrenzschutzes, sondern vor allem der Bundeswehr voranzutreiben. Das geschah zunächst weiter im Rahmen sogenannter UN-Missionen. 1992 wurden deutsche Sanitäter in einen »Blauhelmeinsatz« nach Kambodscha entsandt; 1993 wurden Soldaten der Bundeswehr nach Somalia verlegt, wo – als Teil von UNOSOM II – zeitweise mehr als 1.700 deutsche Militärs stationiert waren. Wozu? Die Bundeswehr habe den Einsatz ganz offen »als Experimentierfeld« genutzt, konstatierte der Militärhistoriker Torsten Konopa in seiner 2023 veröffentlichten Dissertation über deutsche »Blauhelmeinsätze« in Afrika. Sie habe »Abläufe erproben« und die »Materialbeschaffung für den Aufbau schnell verlegbarer Kräfte« forcieren wollen, während die Bundesregierung die Chance gewittert habe, international »größere Mitsprache (…) und Einfluss« zu erlangen. Eher »selten« habe bei den damaligen Einsätzen der Bundeswehr »die schnellstmögliche Lageverbesserung« für die Bevölkerung im Fokus der deutschen Militäroperationen gestanden.
Lieber NATO als UNO
Auslandseinsätze der Bundeswehr fanden bald auch jenseits des UNO-Rahmens statt – an der Seite der Vereinigten Staaten oder unter der Flagge der NATO. Bereits am 16. August 1990 entsandte die Deutsche Marine einen Minenabwehrverband zuerst ins Mittelmeer und dann in den Persischen Golf, um einen Beitrag zur Absicherung des US-Kriegs gegen den Irak zu leisten; »Operation Südflanke« hieß der Einsatz. Parallel stationierte die Bundeswehr Kampfjets und Flugabwehrraketen in der Türkei. 1993 führten deutsche Soldaten erstmals NATO-Überwachungsflüge über Jugoslawien durch. Ab 1995 waren deutsche Truppen umfassend in Bosnien-Herzegowina stationiert. 1999 folgte im Rahmen des völkerrechtswidrigen NATO-Krieges gegen Jugoslawien schließlich zum ersten Mal seit 1945 die Beteiligung deutscher Soldaten an einem ausgewachsenen Kampfeinsatz. Damit war ein weiteres Tabu gefallen; die Entwicklung, die im Jahr 1987 in Bonn vorsichtig angestoßen worden war, kam zu ihrem vorläufigen Höhepunkt.
Mit dem vertraulichen Gutachten des Bundesverteidigungsministeriums vom 16. Oktober 1987 hatte, so formulierte es der Militärhistoriker Detlef Bald in seiner 2005 veröffentlichten »kritischen Geschichte« der Bundeswehr, genaugenommen »das Zeitalter einer neuen Konzeption der Bundeswehr« begonnen. Im Zentrum der Planungen stand nun erstmals nicht mehr nur – und ab 1990 gar nicht mehr – ein etwaiger Krieg gegen die Sowjetunion und die Staaten der Warschauer Vertragsorganisation; in den Mittelpunkt rückten jetzt vielmehr Pläne für Operationen außerhalb des NATO-Bündnisgebietes. Auf konzeptioneller Ebene schlug sich dieser Wandel erstmals in den Verteidigungspolitischen Richtlinien vom 26. November 1992 nieder. Darin stellte das Bonner Verteidigungsministerium offen fest, zu den »vitalen Sicherheitsinteressen«, von denen »die deutsche Politik« sich leiten lasse, gehöre die »Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt«. Damit war nun eine klare legitimatorische Grundlage für deutsche Militäreinsätze geschaffen, die ab sofort den gesamten Globus umspannen konnten. Die juristische Grundlage lieferte wenig später das Bundesverfassungsgericht, als es am 12. Juli 1994 entschied, Auslandseinsätze seien in Zukunft jederzeit erlaubt, wenn der Bundestag sie nur absegne und die Bundeswehr klar in ein »System gegenseitiger kollektiver Sicherheit« eingebunden sei. Das musste nicht die UNO sein, es konnten auch NATO oder EU sein.
Die Umorientierung der Bundeswehr hatte umfassende strukturelle Folgen. Auslandseinsätze in fernen Ländern erfordern kein Massenheer, sondern nur eine geringere Anzahl allerdings bestens ausgebildeter Soldaten, darunter auch Spezialkräfte. Hatte die Personalstärke der Bundeswehr 1987 rund eine halbe Million Soldaten erreicht, so sank sie in den 1990er Jahren kontinuierlich, lag im Jahr 2005 bei rund 250.000 und fiel bis 2015 schließlich auf ungefähr 180.000. Am veränderten Bedarf der Truppe lag es, dass die Wehrpflicht zum 1. Juli 2011 ausgesetzt wurde. Bereits im Jahr 1994 hatte die Bundeswehr mit dem neuen Kommando Spezialkräfte (KSK) eine Sondereinheit erhalten, die bald auch im Ausland eingesetzt wurde, etwa in Afghanistan, dem nächsten Schwerpunkt deutscher Auslandseinsätze nach Exjugoslawien. Auch auf die Rüstung wirkte sich die Umorientierung auf Auslandseinsätze aus. Mitte der 2000er Jahre begannen Bundeswehr und Rüstungsindustrie etwa mit der Planung für die neue Fregatte F 125, die Spezialkräfte und Schnellboote für den Kampf gegen Piraten an Bord haben und bis zu zwei Jahre in fernen Weltgegenden operieren können sollte, ohne in einen Heimathafen einlaufen zu müssen. Für einen Krieg gegen eine Großmacht freilich, den man damals nicht wirklich im Blick hatte, ist sie weniger geeignet. So verfügt sie nicht über eine genügend effiziente Flugabwehr, die für einen solchen Krieg unverzichtbar ist.
Wieder im Großmachtkonflikt
Die nächste große Wende für die Bundeswehr kam im Jahr 2014 mit der heftigen Eskalation des Konflikts um die Ukraine, mit dem Umsturz in Kiew hin zu einer Pro-NATO-Regierung, mit der darauffolgenden Aufnahme der Krim in die Russische Föderation und mit der Entscheidung der NATO-Staaten, nicht einen neuen Machtabgleich mit Russland zu suchen, sondern den Machtkampf gegen Moskau zu eskalieren. Die Bundeswehr hatte es also auf einmal wieder mit einer Großmacht im Osten zu tun. Entsprechend musste umgeplant werden. Um zunächst beim Beispiel Marine zu bleiben: Weil die Fregatte F 125, soeben erst vom Stapel gelaufen und noch längst nicht in Dienst gestellt, für den Krieg gegen eine Großmacht nicht wirklich geeignet war, bestellte die Bundeswehr 2015 sogleich das nächste Kriegsschiff, das Mehrzweckkampfschiff 180, das heute als Fregatte F 126 firmiert und mit dem man auch in Seeschlachten gegen die russische Marine ziehen könnte. Das Bundesverteidigungsministerium beschloss außerdem, ausgemusterte Panzer aus den Abstellhallen der Rüstungsindustrie zurückzukaufen, den Personalbestand der Truppe wieder aufzustocken und auch ansonsten beschleunigt aufzurüsten. Die NATO legte die Militärausgaben der Mitgliedstaaten auf mindestens zwei Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts fest.
Der Schwenk zurück zum Großmachtkonflikt gegen Russland dominierte noch nicht alles. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr auf insgesamt drei Kontinenten, in Europa, Afrika und Asien, erreichten in den 2010er Jahren ihre größte Ausdehnung; nicht personell zwar – nie wieder waren, über ein Jahr verteilt, mehr als 25.000 Soldaten jenseits der Bundesrepublik im Einsatz, wie es 2009 der Fall war –, aber doch bezüglich der Spannweite der Interventionen. Sie reichte von der Entsendung einer geringen Zahl an Militärbeobachtern in UN-Einsätze, etwa in der besetzten Westsahara und im Südsudan, über Marineeinsätze gegen Flüchtlinge und Piraten im Mittelmeer und am Horn von Afrika bis zu ausgewachsenen Einsätzen in Mali und in Afghanistan und Operationen in Nah- und Mittelost – Beteiligungen an einem UN-Einsatz im Libanon und an US-geführten Operationen gegen den IS in Jordanien und im Irak. Politisches Ziel war es, einen breiten Staatengürtel um Europa unter Kontrolle zu halten – zum einen, um die USA, die sich auf den Machtkampf gegen China konzentrieren wollten, zu entlasten, zum anderen, um die EU vor Attacken, welcher Art auch immer, aus dem direkten regionalen Umfeld zu schützen.
Dass aber Deutschland künftig nicht mehr nur am Hindukusch, sondern auch wieder an der NATO-Ostflanke verteidigt würde, spiegelte sich nicht nur in der neuen, stark beschleunigten Aufrüstung und in der neu geplanten Aufstockung des Wehrpersonals wider, sondern auch in den konzeptuellen Grundlagen der Bundeswehr. Das neue »Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr«, das im Juni 2016 präsentiert wurde, hielt zwar noch an der Option auf weltweite Interventionen fest: »Deutschlands sicherheitspolitischer Horizont«, hieß es darin, »ist global.« Dennoch rückte die Rivalität zu Russland als zweite Säule neben Bundeswehreinsätze in aller Welt. Zwar bekräftigte Berlin im neuen Weißbuch noch, eine »belastbare Kooperation« mit Moskau zu wünschen; doch hieß es auch, Russland präsentiere sich international als »eigenständiges Gravitationszentrum mit globalem Anspruch«, weshalb es nun »auf absehbare Zeit eine Herausforderung für die Sicherheit auf unserem Kontinent darstellen« werde. Darauf richtete sich die Bundeswehr nun auch aus.
»Vorneverteidigung« nach Osten
In der Folge wurden die Aktivitäten an der NATO-Ostflanke stetig ausgeweitet. In Litauen etablierte die Bundeswehr zum ersten Mal eine kontinuierliche Präsenz auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion, als sie 2017 die Führung des NATO-Bataillons in Rukla übernahm – ein Revival der alten, in Vergessenheit geratenen Vorneverteidigung, wenn man so will. Die Luftwaffe erhöhte die Zahl ihrer Flüge im Baltikum zur Luftraumüberwachung. Im NATO-Rahmen wurde ebenfalls die deutsche Manövertätigkeit, vor allem in Polen sowie im Baltikum, ausgeweitet. Zugleich wurden zentrale Einsätze der Bundeswehr außerhalb Europas eingestellt. Der Einsatz in Afghanistan endete offiziell am 30. Juni 2021 mit einem umfassenden Scheitern: Die Taliban, die Ende 2001 militärisch besiegt schienen, waren zurück an der Macht. Ende 2023 zog die Bundeswehr zudem aus Mali ab und damit aus ihrem zweiten bedeutenden Einsatz neben dem am Hindukusch. In Mali warf eine neue Regierung, die sich von den Exkolonialmächten unabhängig machen wollte, die europäischen Truppen und damit auch die deutschen aus dem Land.
Mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs wurde die Bedeutung der NATO-Ostflanke für die Bundeswehr dominant, und das Bestreben, sie gegen Russland in Stellung zu bringen, wurde zum Motor einer beispiellosen Hochrüstung – denn erneut entschieden Berlin und die NATO, nicht auf einen raschen Waffenstillstand in der Ukraine zu dringen, sondern die ukrainischen Streitkräfte für einen langen Krieg gegen Russland zu bewaffnen und sich selbst noch stärker als bisher militärisch gegen Moskau in Stellung zu bringen. Den ersten Militarisierungsschub setzte der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 in Gang, als er die »Zeitenwende« ausrief und ein 100 Milliarden Euro schweres Schuldenprogramm ankündigte – mit dem Ziel, gigantische Beschaffungsprogramme für die Bundeswehr zu ermöglichen. Einen weiteren, noch viel massiveren Schub erhielt die Hochrüstung der Bundeswehr, als am 20. Januar 2025 US-Präsident Donald Trump sein Amt antrat und klar machte, Europa müsse im Fall der Fälle in der Lage sein, einen Krieg gegen Russland alleine zu führen. Berlin kündigte an, es werde die Bundeswehr früher als von der NATO gefordert, nämlich schon im Jahr 2029, mit 3,5 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung aufrüsten sowie weitere 1,5 Prozent in die militärisch erforderliche Infrastruktur stecken.
Die Hochrüstung gegen Russland nahm nun endgültig das Niveau des Kalten Krieges an. Auch die Manöverszenarien ähnelten denjenigen aus der Zeit der Systemkonfrontation. Eine der deutlichsten Parallelen waren Großmanöver, mit denen das Heranführen von Truppen, darunter vor allem solche aus den USA, an die NATO-Ostflanke geprobt wurde. Von 1969 bis 1993 hießen diese Manöver »Return of Forces to Germany«, kurz: Reforger; ab 2020 wurden sie unter der Bezeichnung »Defender Europe« wieder aufgenommen. Der Unterschied: War die Bundesrepublik in der Ära der Systemkonfrontation Frontstaat, so fungiert sie heute als Drehscheibe für nach Osten durchreisende NATO-Truppen. Auch andere Schauplätze von Kriegsübungen aus der Zeit vor 1990 erlebten ein Revival, so zum Beispiel die GIUK-Lücke, das Seegebiet zwischen Grönland (G), Island (I) und Großbritannien (UK), das russische U-Boote passieren müssen, sollen sie von ihren Stützpunkten auf der Halbinsel Kola in den Nordatlantik einfahren, um dort den Nachschub aus Nordamerika nach Europa zu attackieren; dort wird inzwischen wieder regelmäßig die U-Boot-Jagd geprobt. Die Bundeswehr nimmt daran teil.
Kanonenfutter gesucht
Auch die Wehrpflicht, die die Ära des Kalten Krieges prägte, kehrt wohl wieder zurück. Der Grund: Wie damals ist in einem Stellungskrieg, wie man ihn exemplarisch in der Ukraine beobachten kann, Kanonenfutter gefragt. In der Bundeswehr geht man davon aus, gut tausend Verletzte pro Tag von der Front zur Behandlung nach Deutschland bringen zu müssen. In der Abschätzung der Opferzahlen zitieren Militärs zuweilen eine Faustregel, der zufolge auf drei Verletzte ein Toter kommt. Demnach stürben in einem NATO-Krieg gegen Russland mehr als 300 Soldaten pro Tag. Daher muss die Bundeswehr kräftig aufgestockt werden. Dass dafür das aktuell von Verteidigungsminister Boris Pistorius geplante Modell ausreicht, das auf direkten Zwang nach Möglichkeit noch verzichten soll, darf man bezweifeln. Darüber hinaus ist der sogenannte Zivilschutz längst wieder ein Thema. Klar – wer in Afghanistan oder in Mali Krieg gegen die Taliban oder andere Dschihadisten führt, wird nicht mit Gegenangriffen auf das eigene Land rechnen müssen, und wenn, dann allenfalls mit vereinzelten Terrorattacken. Wer jedoch einen Krieg gegen eine Großmacht plant, muss Gegenangriffe einkalkulieren und Bunker bauen.
Die Bundeswehr ist also zurück im Kalten Krieg, aus dem sie ursprünglich kam und in den sie nun nach einem Abstecher in Auslandseinsätze in aller Welt zurückkehrt. Allerdings gibt es einige wichtige Unterschiede. Einer besteht darin, dass die NATO-Ostflanke ziemlich weit nach Osten verschoben ist; das hat zur Folge, dass die Bundeswehr inzwischen einen festen Auslandsstützpunkt in Litauen besitzt – ihren ersten, an dem deutsche Soldaten dauerhaft mit ihren Familien leben. Ein zweiter besteht darin, dass die Truppe parallel zur Vorbereitung auf einen etwaigen Krieg gegen Russland auch für einen möglichen Krieg gegen China übt; sie schickt immer wieder Kriegsschiffe, Kampfjets und Einheiten des Heeres in die Asien-Pazifik-Region, nach Japan, nach Singapur oder gar nach Australien, um dort an gegen die Volksrepublik China gerichteten Manövern teilzunehmen. Die berechtigte Frage, ob sich die BRD-Armee damit nicht hemmungslos überdehnt, wird zumindest offiziell nicht gestellt. Und ein dritter Unterschied: Als die Bundeswehr 1955 gegründet wurde und in den folgenden Jahren wuchs und hochgerüstet wurde, befand sich die Bundesrepublik in einer Phase dynamischen Aufschwungs, die sie zu einer der stärksten Volkswirtschaften der Welt machte. Heute hingegen steckt sie in einer Phase des Abstiegs, die sie zur Zeit von Krise zu Krise taumeln lässt.
https://www.jungewelt.de/templates/article-donation.inc.php
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besondere Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben. Ihre E-Mail-Adresse*
Erstveröffentlicht in der jW v. 11.11. 2025
https://www.jungewelt.de/artikel/512167.milit%C3%A4r-wieder-zur%C3%BCck-an-der-nato-ostflanke.html
Wir danken für das Publikationsrecht.