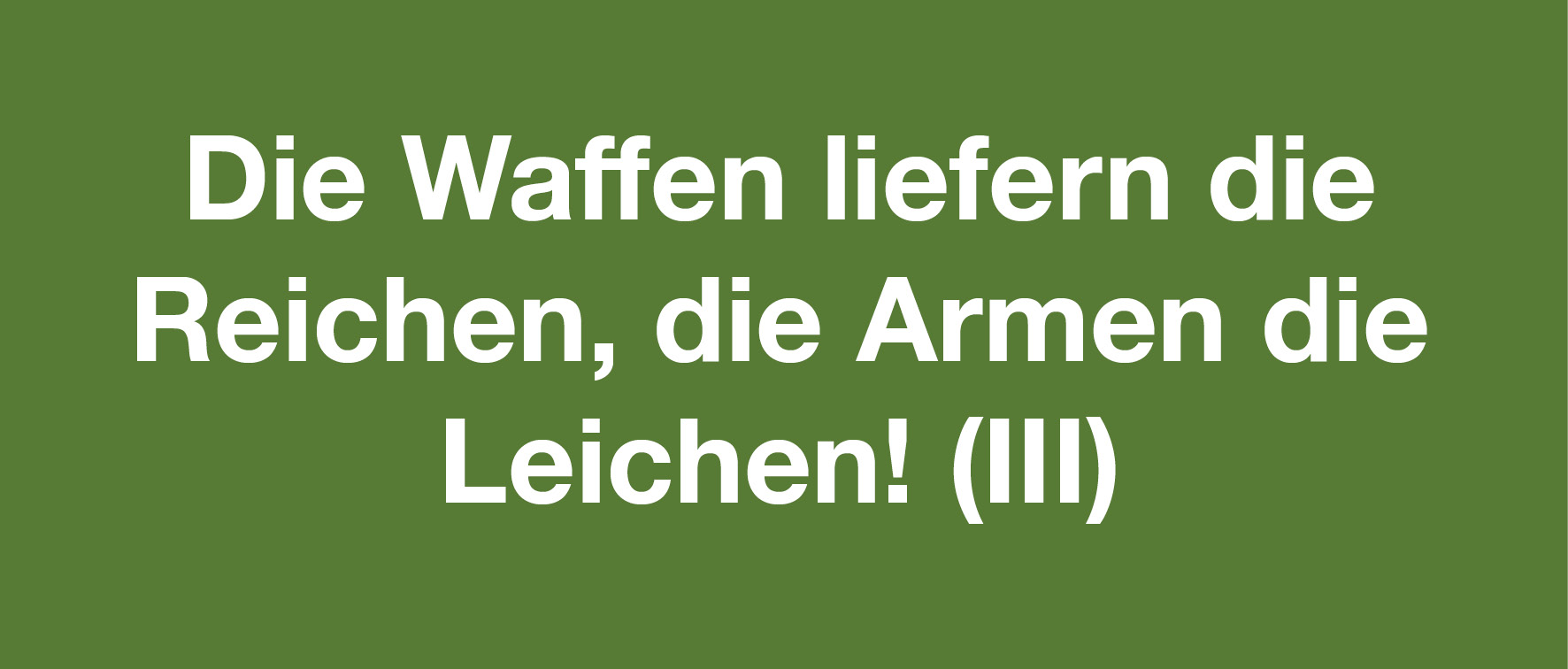Die Geschäfte mit der ukrainischen Transformation
»Je weiter der Krieg voranschreitet, desto besser ist es für die ukrainische Führung, ein westliches Protektorat zu werden.«38
Anfang der 2000er Jahre begannen Verhandlungen zu einem Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine; Ende 2013 wollten beide Seiten unterzeichnen. Das Angebot war nicht sonderlich gut, die IWF-Auflagen für Kredite sehr hart. Russland versuchte mit einem Mix aus Sanktionsdrohungen und günstigen Gaspreisen zu erreichen, dass das Abkommen nicht zustande kommt. Der zwischen beiden Seiten lavierende ukrainische Präsident Janukowytsch machte unerwartet einen Rückzieher, was den Aufstand auf dem Maidan auslöste. Janukowytsch floh und im Februar 2014 wurde eine proeuropäische Übergangsregierung eingesetzt. Gleichzeitig begann Russland mit der Annexion der Krim (Februar/März), im Donbass wurden die Volksrepubliken Donezk und Lugansk proklamiert (April/Mai). Im Juni unterschrieb der neu gewählte ukrainische Präsident Poroschenko das Assoziierungsabkommen. Es fügt sich in den Rahmen der »Östlichen Partnerschaft« der EU ein, eine von Polen angeregte Initiative mit dem Ziel, die Staaten der früheren Sowjetunion enger an den Westen zu binden und vor allem die Ukraine dem russischen Einfluss zu entziehen.
2015 verbot Poroschenko alle drei kommunistischen Parteien in der Ukraine. Er ist der Hauptverantwortliche für die nationalistische Politik der »Entrussifizierung« und der vollständigen Durchsetzung der ukrainischen Sprache.
Am 1. September 2017 trat das Abkommen mit der EU in Kraft, begleitet von einem Hilfsprogramm für die Ukraine im Umfang von elf Milliarden Euro für den Zeitraum 2014 bis 2020. Der Vertrag von 2135 Seiten lässt sich »durchaus als Dokument einer freiwilligen Unterwerfung lesen. … Auf ganz klassische Art verpflichten die Artikel über den Handel die Ukraine, die meisten Schranken für den freien Wettbewerb … zu beseitigen.« »Das Assoziierungsabkommen ist in gewisser Weise Ausdruck einer kolonialen Haltung, gab 2013 ein westlicher Diplomat in Kiew zu.«39
Vom Tiefkühlverfahren für Gemüse bis zur Privatisierung der öffentlichen Einrichtungen und dem freien Kapitalverkehr – überall diktiert Brüssel dem »Partner« den juristischen Rahmen. Dazu gehört auch die Verpflichtung, das »Lobbying« zu legalisieren – von wegen »Kampf gegen die Korruption«! Artikel 7 behandelt die »Annäherung im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik«. Das Kapitel »Zusammenarbeit im Energiebereich einschließlich Nuklearfragen« schreibt vor, dass »Energiequellen, -lieferanten, -transportwege und -transportverfahren« diversifiziert und alle aus der Sowjetunion stammenden Normen zurückgenommen werden sollen. Mit anderen Worten: Die Ukraine muss ihre Wirtschaft »entrussifizieren«.
Auf der Ukraine Reform Conference 2018 wurde die Privatisierung staatlicher Unternehmen beschlossen – gegen den Willen der Bevölkerung. Einer Umfrage zufolge waren damals nur zwölf Prozent der UkrainerInnen pro Privatisierung. 2020 hob Präsident Selenskyj das Verkaufsverbot für Ackerland auf, um die Bedingungen für einen Fünf-Milliarden-Dollar-Kredit des IWF zu erfüllen. Im selben Jahr legte der IWF eine Gesetzesvorlage zur Re-Privatisierung des Bankensektors vor.
Ukraine als Experimentierfeld …
Die Ukraine Recovery Conference im Juli 2022 in Lugano verabschiedete eine Art Marshall-Plan zum Wiederaufbau der Ukraine im Volumen von 1,25 Billionen Dollar. Der Plan ist eine lange Liste von Maßnahmen, um ausländische Investitionen anzuziehen: Privatisierung von Banken und staatlichen Unternehmen bis hin zu den AKWs, kapitalfreundliche Finanz-, Steuer- und Zollpolitik, »gezielte« (statt universelle) Sozialhilfe, vor allem aber »Abschaffung der überholten Arbeitsgesetzgebung«.
In Kriegszeiten wird Wirtschaftspolitik normalerweise staatlich-interventionistisch, paradoxerweise fährt Selenskyj mit Privatisierungen fort und senkt Steuern. Außerdem wurden Arbeitsschutzgesetze gestrichen. Mitte August 2022 unterzeichnete er ein Gesetz, das kleinen und mittleren Betrieben mit bis zu 250 Beschäftigten – hier arbeiten 70 Prozent der ukrainischen Werktätigen – erlaubt, das Arbeitsgesetz auszusetzen; dann gilt nur noch der Arbeitsvertrag.
Am 1. September lancierte Selenskyj die »große Privatisierung«. Am 6. September durfte er virtuell die Eröffnungsglocke der New Yorker Börse läuten und lud Investoren aus aller Welt ein, ukrainische Aktien im Wert von über 400 Milliarden Dollar zu kaufen. USAID hilft beim Verkauf und garantiert die Sicherheit des Investments. Beteiligt ist außerdem die Weltbank und vor allem private Investoren. Selenskyj traf sich mehrfach virtuell mit Larry Fink, dem Gründer von BlackRock.40
Ein weiterer Gesetzentwurf will einen Arbeitstag von bis zu zwölf Stunden einführen und den Kündigungsschutz aufheben.41 Die neuen Arbeitsgesetze hatte Selenskyj bereits 2021 vorgelegt, im Parlament dafür aber keine Mehrheit erhalten. Nachdem im März 2022 im Zuge des Kriegsrechts die restlichen elf oppositionellen Parteien verboten worden waren, reichte es im Sommer 2022 dann für die Mehrheit.
Schon vor dem Krieg war die Ukraine (zusammen mit Moldau) das ärmste Land in Europa. 2021 war der gesetzliche Mindestlohn halb so hoch wie in Bulgarien. 2022 ist das BIP der Ukraine um mehr als 30 Prozent, die Löhne um weitere 25 Prozent gesunken. Der Krieg hat die sowieso schon extreme Ungleichheit weiter verschärft. 17,6 Millionen Menschen – das sind fast 40 Prozent der ukrainischen Bevölkerung – sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Während sich die Reichen vom Kriegsdienst freikaufen können und inzwischen in der West-Ukraine oder im Ausland leben.
… und Lieferant von Arbeitskräften
Schon Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn, die 2004 in die EU aufgenommen wurden, hatten der EU ein großes Arbeitskräftepotenzial geliefert. Die Produktionsverlagerungen in die neuen Mitgliedstaaten waren essenziell für die europäische und vor allem für die deutsche Industrie. Nun soll die Ukraine folgen. Das Assoziierungs-Abkommen sieht die »schrittweise Liberalisierung der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen zwischen den Vertragsparteien« vor. Solche Leistungen erbringen die ukrainischen Geflüchteten inzwischen in den EU-Ländern vor Ort. Mitte Februar 2023 meldete die Bundesagentur für Arbeit, seit Beginn des Kriegs seien rund 65 000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte UkrainerInnen hinzugekommen plus 21 000 in Minijobs. Diese Zahlen würden nach Beendigung von Integrations- und Berufssprachkursen deutlich steigen. In Befragungen an der Grenze gaben 66 Prozent der Flüchtlinge an, einen höheren Bildungsabschluss zu besitzen – der Durchschnitt in der Ukraine ist 29 Prozent, in der EU 33 Prozent. »Ganz bewusst« versuche man, diese Qualifikationen »nutzbar zu machen«, anstatt die Leute sofort in Helferjobs zu vermitteln. Man werde einen noch höheren Anteil in Jobs bringen als bei der Flüchtlingswelle 2014 bis 2016. Laut einer Studie wolle jeder vierte Flüchtling aus der Ukraine langfristig in Deutschland bleiben. Unterstützt werde diese Entwicklung dadurch, dass auch immer mehr Männer im arbeitsfähigen Alter nach Deutschland kämen – ungeachtet der Wehrpflicht in der Ukraine.
»Die Waffen liefern die Reichen, die Armen die Leichen« (Demo-Plakat)
Der Krieg liegt wie eine Bleikappe über allem. Westeuropa und die BRD werden zunehmend hineingezogen – oder schieben sich rein: Der Beschluss der 27 EU-Verteidigungsminister am 30. August 2022, eine europäische Mission zur Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte zu entsenden, war eine direkte Initiative der EU. »Die Umwandlung der EU-Kommission in eine Kommandozentrale und politisch-militärische Koordinierungsstelle der interimperialistischen Kriegsanstrengungen ist ein historischer Wandel.«42 Militarisierung ist ein enormer Angriff nach innen.»Ein Düsenflugzeug bedeutet soundsoviele Schulen und Krankenhäuser weniger. Jedes Mal, wenn wir unseren Militärhaushalt aufstocken, greifen wir uns selbst an.« (Noam Chomsky)
Auf den klassischen Friedensdemos sind Leute über 60 in der Mehrheit. Für viele junge Leute ist »Frieden« kein Wert mehr – vielleicht weil sie keine Eltern haben, die noch Krieg erlebt haben? Wer mit der Propaganda der »humanitären Kriege« aufgewachsen ist, fühle sich moralisch verpflichtet zu uneingeschränkter militärischer Hilfe, meint Habermas. Selbst Fridays for Future fordern Frieden und gleichzeitig Waffen für die Ukraine. Das Duo Cohn-Bendit/Leggewie ist opportunistisch genug, sich auch hier noch reinschleimen zu wollen: »Klimaschutz und Waffenlieferungen sind kein Widerspruch.«43 Solche Idioten sind bald Schnee von gestern. Unser größtes Problem sind aber lautstarke Linksradikale, die im Chor mit den Grünen Sanktionen gegen Russland und Waffen für die Ukraine fordern – ohne dass sie irgendeinen Einfluss darauf hätten, wer wem zu welchem Zweck welche Waffen liefert. »Antinationale« verteidigen einen nationalistischen »Volkskrieg«. Ein Erbe der Antideutschen, die vor drei Jahrzehnten jedem Proleten Antisemitismus vorhielten, der es wagte, »wir« zu sagen, und gleichzeitig »Bomben auf Bagdad« forderten. Im Unterschied zu damals räumen heute viele Waffenlieferungsbefürworter mit ihren NS-Vergleichen sogar ihr früheres Beharren auf der Singularität der Vernichtungspolitik der Nazis ab.44
Aber die Ukraine ist nicht Spanien 1936 oder Rojava. Auch große Teile der ukrainischen Linken sprachen zunächst vom »Recht auf nationale Selbstverteidigung«. Vor allem Anarchisten hatten sich nach dem russischen Einmarsch zu den Territorialen Verteidigungskräften gemeldet, die mittlerweile in die Armee integriert wurden. Eine große Rolle spielt(e) hier Sotsyalnyi Rukh (Soziale Bewegung), nach eigenen Angaben mit rund 100 Mitgliedern die bedeutendste »antikapitalistische Organisation« der Ukraine: »Heute kämpfen alle, alle stehen an der Front und verteidigen die Ukraine: Linke, Anarchisten, die Gewerkschaften, die Mittelschicht, die extreme Rechte«, rühmte sich deren Mitglied Wladislaw Starodubtschew in der Konkret. Es gibt aber auch ukrainische Linke, die sich im »imperialistischen Krieg zwischen Nato und Russland auf dem Boden der Ukraine« auf keine Seite stellen wollen. Die Erfahrungen an der Front haben auch einige der anarchistischen Vaterlandsverteidiger zum Umdenken gebracht. Die Brutalität des Abnutzungskriegs ändert nicht nur die Moral der Soldaten – es gibt inzwischen viele Desertionen –, sondern auch die politischen Positionen im Westen und die Bereitschaft in der breiten Bevölkerung, den Krieg weiterhin zu unterstützen oder zu ignorieren.45
Auch auf der Schwarzer/Wagenknecht-Kundgebung waren viele, die zunächst für Waffenlieferungen eingetreten waren, aber angesichts der militärischen Eskalation und der vielen Toten jetzt für Waffenstillstand und Verhandlungen plädieren.
»War! – What is it good for? Absolutely nothing!«
(Edwin Starr)
Standen nach dem russischen Überfall UkrainerInnen Schlange vor den Rekrutierungsbüros, so ist der Enthusiasmus verflogen, seit die Soldatenfriedhöfe immer größer werden. Die Armee hat Probleme, Soldaten zu finden, und greift zu illegalen Methoden. Viele verstecken sich oder haben den Weg ins Ausland gefunden. Allerdings sollen schon 10 000 Kriegsdienstverweigerer an der Grenze verhaftet worden sein.
In einem bemerkenswerten Interview äußerten sich ukrainische Soldaten Anfang März zu ihrer Situation in Bachmut und sprachen von einer Überlebensquote von 30:70. Männer würden nach zweiwöchigem Crash-Kurs an die vorderste Front geschickt. Einige forderten den Rückzug.
Russland hat entgegen der Versprechen Putins im Sommer 300 000 Mann zwangsmobilisiert, was den Krieg näher an die Bevölkerung gebracht hat. Das hat zu einer massiven Flucht junger Männer ins Ausland geführt. Im Gegensatz zu Ukrainern bekommen sie in der BRD allerdings keine Anerkennung als Flüchtlinge, da ihr Fluchtgrund nicht »politisch« sei; baltische Staaten schieben Kriegsdienstverweigerer ab. In einem Video-Appell vom 11. März beklagten russische Reservisten, dass sie verheizt werden. Putin solle sich nicht auf dem Papier, sondern vor Ort um die Lage kümmern.
Mitte Februar 2023 jammerte die Weltwoche: »Kürzlich publizierte das Institut Yougov eine Umfrage: Wie viele Deutsche würden ihr Land bei einen Angriff verteidigen? Das Ergebnis: 11 Prozent. In Worten: elf. 5 Prozent freiwillig, der Rest gezwungenermaßen. … Was ist da falsch gelaufen?«
Wer könnte ernsthaft Verhandlungen erzwingen?
China hat mehrfach angeboten, Russland zu bremsen, Brasilien hat sich als Vermittler angeboten. Nun will der Papst nach Russland und in die Ukraine fliegen. Sogar Ischinger, der langjährige Vorsitzende der »Münchner Sicherheitskonferenz« spricht sich plötzlich für Verhandlungen aus. Sobald die USA ihre Unterstützung zurückziehen und die Neutralität der Ukraine garantieren, wäre der Krieg erstmal gestoppt.
Ein Waffenstillstand wäre kein Frieden, sondern nur eine Atempause angesichts der Krisen auf allen Ebenen. Damit der Konflikt nicht wieder nur »eingefroren« wird wie 2014 und alle Seiten derweil weiter aufrüsten, bräuchte es eine neue breite, transnationale, soziale und kulturelle Bewegung von unten wie damals gegen den Vietnam-Krieg. Nur sie könnte wirklich was ändern.
Ein Schritt wäre, dass alle Atommächte ihre Nuklearwaffen nur noch auf ihrem nationalen Hoheitsgebiet stationieren. Die Bewegung der Blockfreien fordert das seit Jahren. (Übrigens hatte sich der Bundestag 2010 mit großer Mehrheit für den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland ausgesprochen.) Ami go home!
Entscheidend wird die Entwicklung der Klassenkämpfe in Russland, Südafrika, Indien, Iran, China… und vor allem in den USA sein. Sie sind zentral dafür, wie es auf der Welt weitergeht.
»I dedicate this show to the
American deserters«
(Jimi Hendrix 1969)
Die Ukraine: »Im Grenzland des Weißseins«
In ihrem einem lesenswerten Artikel in Luxemburg zeigt Olena Lyubchenko, wie »Ukrainisch-Sein« mit »Europäisch-Sein« durch Konzepte von Rasse, Klasse, Geschlecht und Sexualität vermittelt wird. Die Eliten definieren sich zunehmend als »weiße« und »europäische« »ukrainische Nation«. »Das Konzept der ›Selbstbestimmung‹ … wird instrumentalisiert und in der eurozentrischen Denkweise westlicher und ukrainischer Eliten von seinen kommunistischen und antifaschistischen Wurzeln abgetrennt.«
Ukrainische Proletarierinnen leisten in Italien, Polen, der BRD, den USA und Kanada Pflegearbeit in Privathaushalten. Seit 2014 ist ihre Zahl stark angestiegen, 2020 arbeiteten 2,2 bis 2,7 Millionen UkrainerInnen im Ausland, was 13 bis 16 Prozent der Gesamtbeschäftigung im Land entspricht. Die ukrainische Reproduktionsarbeit »dient auch dazu, eine Grenze um die europäische Zivilisation aufrechtzuerhalten«. Die ukrainische »Leihmutterschaftsindustrie« erzeugte im Jahr 2018 Einnahmen von über 1,5 Milliarden US-Dollar. Gegenüber der indischen oder thailändischen Konkurrenz setzt sie auf den Wettbewerbsvorteil, dass ukrainische Frauen als »weiß« und »europäisch« gelten. Die Ukraine ist womöglich international führend in der Branche. Während die zukünftigen Eltern 38 000 bis 45 000 US-Dollar bezahlen, erhalten die Leihmütter nur 300 bis 400 US-Dollar monatlich und ca. 15 000 US-Dollar am Ende der Schwangerschaft (der Mindestlohn in der Ukraine liegt bei etwa 180 Euro im Monat).
Ukrainische Eizellenspenderinnen und Leihmütter werden als »besonders fruchtbar« dargestellt und als »Trägerinnen des Weißseins« konstruiert. Deshalb seien sie Leihmüttern aus dem globalen Süden vorzuziehen. »Ein normaler Körperbau und ein normales Körpergewicht, helle Augen, Haare und Haut, feine Gesichtszüge sprechen für ukrainische Spenderinnen.« Diese Zuschreibungen homogenisieren das »Ukrainischsein«. Im ukrainischen Nationalismus ist kein Platz für Multikulti. Anders als im globalen Süden, wo Armut das Hauptmotiv sei, kämen die meisten Spenderinnen aus der Mittelschicht, wird behauptet. Aber in Interviews gaben ukrainische Leihmütter an, dass sie durch den Krieg in der Donbass-Region vertrieben worden sind, anderen ging es darum, ihr geringes Einkommen aufzubessern. (Luxemburg, Oktober 2022)
Fußnoten:
[38] Raúl Sánchez Cedillo: Dieser Krieg endet nicht in der Ukraine. Argumente für einen konstituierenden Frieden. Februar 2023, S. 30.
[39] Pierre Rimbert: »Kiews falsche Freunde«, in Le Monde Diplomatique 10/22.
[42] »Die ukrainische Volkswirtschaft ist offen für Investoren«, businesswire,
6.9.2022.
[41] Siehe »Ukraine’s anti-worker law comes into effect«, OpenDemocracy,
25.8.2022.
[42] Cedillo, a.a.O., S. 287.
[43] FAZ, 26.2.2023.
[44] Lesenwert: Ingar Solty »Knoten im Kopf« in junge welt, 1.3.23.
[45] Nick Brauns »Stimmen aus der Klandestinität« in junge welt, 23.2.23.
Hier ist die Quelle:
https://www.wildcat-www.de/wildcat/111/w111_krieg.html