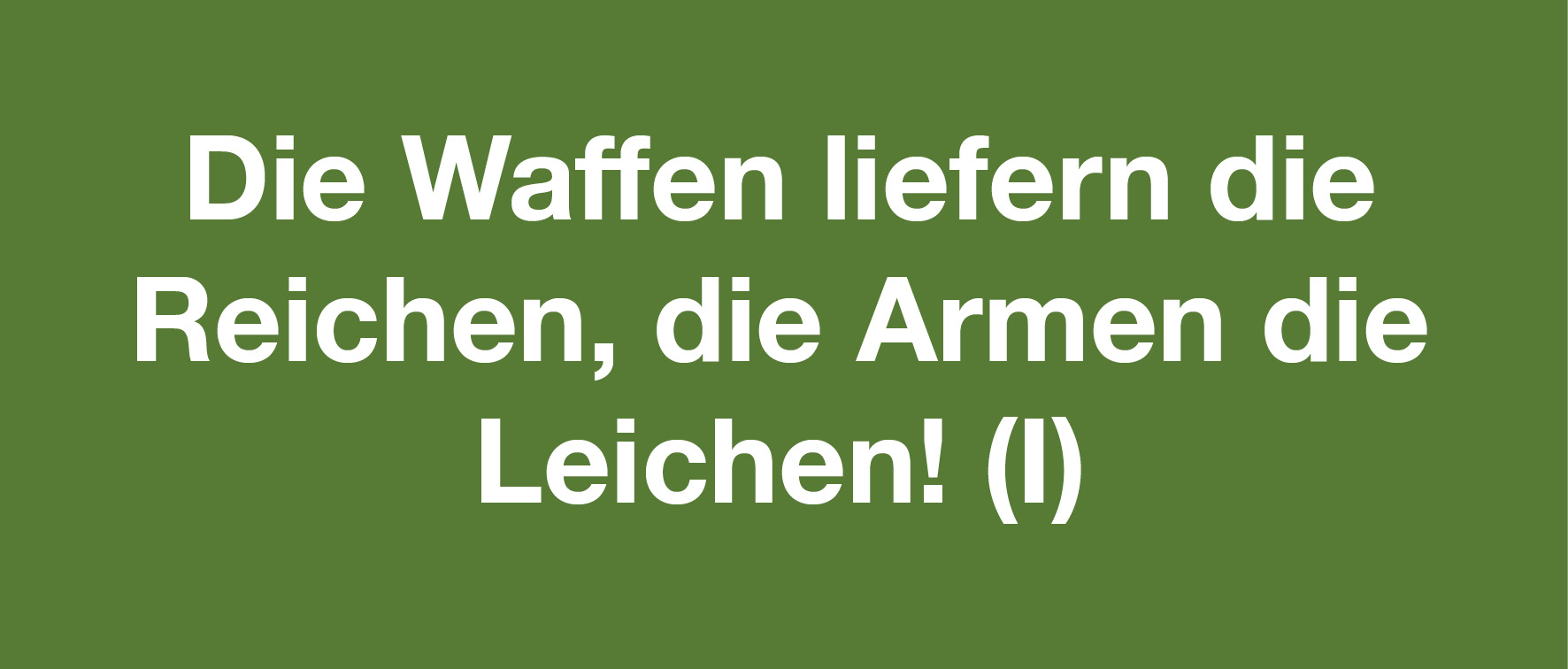Ukrainekrieg
Dies ist der erste Teil eines 12-seitigen Artikels der Zeitschrift „wildcat“, die wir in drei Teilen hier wiedergeben. Er ist gut recherchiert und setzt sich kritisch mit der Politik der USA bzw. des sog. „regelbasierten Westens“ auseinander. Der Artikel verbindet diese desillusionierende Betrachtung jedoch nicht mit einer Parteinahme für eine der sich im Kriegskonflikt befindlichen Länder sondern hält an einem Klassenstandpunkt fest. Überhaupt ist es sehr erfreulich, dass sich in der Zwischenzeit immer mehr Strömungen der Linken von der anfänglich dominierenden „Ukraine-Solidarität“ gelöst haben und konsequent antimilitaristisch argumentieren. Der Name Wildcat ist auf die englische Bezeichnung für Aktionen außerhalb institutioneller Einrichtungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Arbeitern rückführbar.
Die die Zeitschrift tragende Gruppe trägt ebenfalls den Namen wildcat. Gruppe und Medium wurden inspiriert durch den italienischen Operaismus, der im Italien der 70er-Jahre eine bedeutende Strömung innerhalb der Linken und der Arbeiterbewegung war und auf selbständig geführte Arbeiter:innenkämpfe setzte, in denen sich Betriebsaktivisten und sozialistische Intellektuelle zusammenfanden. (mehr dazu siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Operaismus). Der heutige Post-Operaismus der wildcat ist international vernetzt. Einzelne Beiträge der Zeitschrift gibt es online in verschiedenen Sprachen – insgesamt sind es zehn.
Zum Weiterlesen in Sachen Operaismus/Post-Operaismus hier zwer Bücher:
https://schmetterling-verlag.de/page-5_isbn-3-89657-661-5.htm und https://www.mandelbaum.at/buecher/dominik-goetz/operaismus/
Wir danken der Redaktion der wildcat für das Abdruckrecht. (Jochen Gester)
»Putin glaubt, dass wir Weicheier sind«
(Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz)
Daran, dass im folgenden Artikel noch viel zu oft Länder als Subjekte vorkommen, merkt ihr, dass wir mit unserer Analyse noch nicht sehr weit sind. Zu »Analysen« wie der von Heusgen haben wir allerdings einiges zu sagen. Wir denken, das rechtfertigt die Veröffentlichung des Work in progress.
Die Ukraine ist wegen ihrer geostrategischen Lage zum Schauplatz eines Stellvertreterkriegs zwischen der Nato und Russland geworden. Die gescheiterte »militärische Spezialoperation« wurde zum blutigen Abnutzungskrieg. Man muss davon ausgehen, dass schon 100 000 Soldaten getötet worden sind; beide Seiten behandeln die Zahlen als Geheimnis. »Die Russen, … um die desolate Kriegskampagne zu verschleiern. Die Ukrainer, um die Moral ihrer geschundenen Bevölkerung aufrechtzuerhalten« schrieb die NZZ.1 Die UNO verzeichnete im ersten Kriegsjahr 8006 zivile Opfer (7519 Erwachsene und 487 Kinder), geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Fast acht Millionen Menschen sind in die Nachbarländer geflohen, davon drei Millionen nach Russland. Dazu kommen 5,3 Millionen Binnenvertriebene. Die zivilen Opfer trägt zum größten Teil der Osten der Ukraine, während sich in Lviv die Immobilienpreise seit Kriegsbeginn verdoppelt haben. In Charkow hängen weniger ukrainische Fahnen als hier in Deutschland. Der Krieg hat auch Aspekte eines Bürgerkriegs und schafft neue Formen der Klassengesellschaft.2
Der russische Überfall lässt sich weder mit den Völkerrechtsbrüchen des Westens in der Vergangenheit rechtfertigen noch mit den gebrochenen Versprechen der Nato, sich nicht bis an die Grenzen Russlands auszudehnen. Die innenpolitische Situation in Russland ist schon lange bedrückend; Putin hat im Bündnis mit der orthodoxen Kirche die linke Opposition zerstört und nutzt den äußeren Feind, um inneren Zusammenhalt zu schaffen.
Putin ist nicht Hitler – und will nicht enden wie Saddam Hussein. Vor dem Einmarsch der USA war Saddam ihr Verbündeter, der 1980 den Iran angriff und 1988 die Kurden mit Giftgas massakrierte. Das hatten nur Linke thematisiert; aber im Nachhinein benutzten es die USA als Begründung dafür, ein Land in die Steinzeit zu bomben. Das gleiche mit Gaddafi usw. Putin war willkommen als brutaler Partner im »Krieg gegen den Terrorismus« (Krieg in Tschetschenien), wurde dann aber von Obama öffentlich auf die Stufe eines Saddam gestellt (»Regionalmacht«).3
Seit 2014 wurde die Ukraine durch die USA auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet. Annahme war allerdings eine schnelle Eroberung großer Landesteile durch Russland mit anschließendem Guerillakrieg. Geliefert wurden dafür nötige Waffensysteme wie die tragbaren Panzerabwehrlenkwaffen Javelin. Kleingruppentaktiken wurden trainiert. Stattdessen entwickelte sich ein Stellungskrieg, auch dank der schnellen Lieferung sowjetischer Panzer und Artillerie aus Osteuropa und der Zurverfügungstellung von Zielkoordinaten. Dieser Krieg ist für den Westen viel teurer, als es ein Guerillakrieg gewesen wäre. Allein die USA haben der Ukraine insgesamt 46,6 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung gestellt, was mehr als zwei Dritteln des gesamten jährlichen Verteidigungshaushalts Russlands (65,9 Milliarden Dollar) entspricht. Ausländische Finanzhilfen decken mehr als die Hälfte des ukrainischen Staatshaushalts ab. Diese völlige Abhängigkeit von ausländischer Hilfe erzwingt ein triumphalistisches Narrativ, wonach der ukrainische Sieg kurz bevorstehe – falls der Westen noch mehr Geld und immer leistungsfähigere Waffen schickt. Um das Narrativ aufrechtzuerhalten, werden ukrainische Soldaten in blutigen Schlachten geopfert, wie bei der Gegenoffensive um Cherson und den Belagerungen von Bachmut und Soledar. Bachmut verteidigte man nach eigenen Aussagen in einer »Abnutzungsschlacht«, um den russischen Truppen möglichst hohe Verluste zuzufügen.
Baerbock und die Nato begründen ihre Unterstützung der Ukraine mit »Werten«. Die Ukrainer sollen für die Werte kämpfen, die zum Beispiel in den USA verfallen. Dass der Osten der Ukraine dabei zerstört wird – wenn auch nicht im Ausmaß des Irakkriegs, der zwischen 800 000 und 1,3 Millionen Menschen das Leben kostete – ist eingerechnet. Denn U. v. d. Leyen hat erkannt: »Ukrainer sind bereit, für die europäische Perspektive zu sterben.«4
Vorgeschichte des Ukrainekriegs
Die Nato hat drei Jahrzehnte lang ihre Ausdehnung bis an die Grenzen der russischen Föderation vorangetrieben und dabei bewusst alle »roten Linien« Moskaus überschritten. Die USA und die BRD hatten Gorbatschow ausdrücklich und wiederholt versprochen, die Nato »nicht einen Zentimeter nach Osten« zu erweitern, nachdem er den Warschauer Pakt aufgelöst hatte. Bereits 1997 stimmte sein Nachfolger Jelzin der ersten Osterweiterung der Nato zu mit der Bemerkung, er tue »das nur, weil der Westen (ihn) dazu zwingt«. Im selben Jahr schloss die Nato mit der Ukraine ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft. 50 ehemalige Senatoren, pensionierte Militärs, Diplomaten und Wissenschaftler nannten damals in einem Schreiben an Präsident Clinton die Nato-Erweiterung einen politischen Fehler »von historischem Ausmaß«. Danach folgten noch vier weitere Osterweiterungen.
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 machte Putin in einer Rede deutlich, dass Russland eine Einbeziehung der Ukraine in die Nato nicht akzeptieren werde. Die Nato provozierte weiter, indem sie der Ukraine 2008 die (spätere) Mitgliedschaft versprach und seither dort Manöver durchführte.
Jetzt stellte Putin seine Strategie um und begann, seinen Machtbereich gegen den Westen auszurichten. Das war auch eine (späte) Reaktion auf die neue Doktrin der Nato von 1999, die Kriege aus drei Gründen rechtfertigte: »humanitäre Intervention«, »Migrationsbewegungen«, »Ressourcensicherung«. »Humanitär« sollte der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen Serbien 1999 sein. 1000 Flugzeuge, darunter deutsche, bombardierten zweieinhalb Monate lang Städte und Industrieanlagen, Infrastruktureinrichtungen, Kulturinstitutionen und Wohnhäuser. Senator Joe Biden an vorderster Front: Im Juni 1998 erklärte, dass er schon im Bosnienkrieg für einen Bombenkrieg war: »Ich habe vorgeschlagen, dass wir Belgrad bombardieren … und alle Brücken über die Drina in die Luft jagen.«5 Im Oktober 1998 sagte er: »Die Nato hat das Recht, in innere Angelegenheiten europäischer Länder zu intervenieren ohne die explizite Autorisierung durch den UN-Sicherheitsrat.«6
Obwohl US-Kampfjets am 7. Mai 1999 die chinesische Botschaft in Belgrad bombardierten, blieb China damals neutral.
Unter Obama wurde Biden Vizepräsident und Ukraine-Beauftragter. Nachdem der Nato-Beitritt der Ukraine 2008 am Widerstand Frankreichs und der BRD gescheitert war, konzentrierte er sich von 2009-2017 zusammen mit Victoria Nuland7 im Außenministerium darauf, das Land faktisch in die Nato zu integrieren. 2014 beschloss der US-Kongress den Ukraine Freedom Support Act. Als erste Maßnahme wurden Waffen für 100 Millionen Dollar genehmigt. Insgesamt lieferten die USA seither Waffen im Wert von 30 Milliarden Dollar.9 Die Ukraine war jahrelang weltweit das Land mit dem höchsten jährlichen Zuwachs der Rüstungsausgaben. Im Yavoriv Combat Training Center in der West-Ukraine haben die USA bis Anfang 2022 mehr als 27 000 ukrainische Soldaten trainiert. 2020 erklärte die Nato schließlich, mit der Ukraine die »Interoperabilität« erreicht zu haben, die gegenseitige Abstimmung der Militär- und Kommandostrukturen, Voraussetzung für eine Nato-Mitgliedschaft.10 Nach der Ankündigung auf dem Nato-Gipfel im Juni 2021, dass die Ukraine nun doch aufgenommen werde, explodierte die Situation. Ende September 2021 führte die Ukraine gemeinsame Manöver mit Nato-Verbänden durch, Russland zog Truppen an der Grenze zusammen.
Rote Linien
Teilen des US-Sicherheitsapparats war klar, dass die russischen Einwände keine »Muskelspiele« waren. William Burns, der heutige CIA-Direktor, schrieb in seiner Zeit als US-Botschafter in Moskau von 2005 bis 2008 Dutzende von diplomatischen Depeschen; sie sind heute über WikiLeaks öffentlich zugänglich. Immer wieder warnte er, die Erweiterung der Nato werde in ganz Russland »weit über Putin hinaus als große Bedrohung und Provokation angesehen«; oder »der Beitritt der Ukraine zur Nato ist für die russische Elite (nicht nur für Putin) die äußerste aller roten Linien«. Das würde die Hardliner und Nationalisten in Russland aufputschen und stärken und könne zum Krieg führen. Solche Warnungen ziehen sich bis 2019, als auch die vom Pentagon finanzierte Rand Corporation berichtete, die Ängste vor einem »direkten militärischen Angriff auf Russland« seien »sehr real« und könnten die russische Führung zu »überstürzten, selbstzerstörerischen Entscheidungen« veranlassen.11
Putin konnte sich auch deswegen so lange an der Macht halten und das Land in eine Autokratie umbauen, weil er den Eindruck vermittelte, ein Konzept gegen die aggressive Nato zu haben! Branko Marcetic zitiert einen russischen Analysten, demzufolge die Forderung nach einem Nato-Beitritt der Ukraine »den ›Amerikahassern‹ in Russland geholfen [habe], an die Macht zu kommen, und der Vision der Hardliner von einer ›Festung Russland‹ Legitimität verschafft« habe.12
Im Krieg um die »große Weltinsel«
In ihrem Aufsatz »Der Kampf um Eurasien – Von der Globalisierung zurück zur Geopolitik« beschreibt Birgit Mahnkopf, wie die USA nach dem Ende des Kalten Kriegs gezielt die von Frankreich, Deutschland und Russland angestrebte »europäische Friedensordnung« verhinderten. Denn diese hätte die Nato überflüssig gemacht, einen riesigen Binnenmarkt geschaffen und einen mit China wirtschaftlich kooperierenden weiteren Konkurrenten der USA hervorgebracht. »Noch immer kreisen geopolitische Konflikte um dieselbe Region wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals hatte der britische Geograph Halford MacKinder die riesige Landmasse des eurasischen Raums unter Einschluss Afrikas als die große ›Weltinsel‹ bezeichnet, die drei nah zusammenliegende Kontinente umfasst und das ›Herzland‹ der Welt darstelle. In diesem befinden sich heute die letzten größeren Ressourcen sowie die letzten vermuteten Reserven an fossilen Rohstoffen – und die weitaus größte Menge an Mineralien und Metallen, die für alle zivilen wie militärischen Technologien der Digitalisierung benötigt werden, doch ebenso für die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen und die E-Mobilität, für die chemische Industrie und die Flugzeugbranche sowie für die medizinische Ausstattung moderner Industriegesellschaften. … [Es ist] zugleich jene Region, von der Zbigniew Brzezinski, einflussreicher Berater der US-Regierungen von Ronald Reagan bis Barack Obama,13 einst schrieb, dass, wer diese riesige Landmasse beherrsche, auch die Welt beherrscht. Daher, so lautet seit den frühen 1990er Jahren das Credo der US-Außenpolitik, dürfe keine Macht die Fähigkeit erlangen, die (kontinentfernen!) USA aus Eurasien zu vertreiben. Diesem Zweck dienen die rund 750 US-Militärbasen in 80 Ländern, die einen ›eisernen Ring um Eurasien‹ gelegt haben und heute die erweiterte pivot area des indo-pazifischen Raumes mit einschließen.«14
Die Neo-Konservativen in den USA sehen das als Kampf gegen die Zeit, umstritten ist lediglich, ob der Hegemon allmählich oder mit einem großen Knall abtritt. Während des Irakkriegs 2003 gab ein Neocon-Thinktank den USA noch maximal 15 Jahre; dann werde China ihren militärischen Handlungsrahmen so weit einschränken, dass sie nicht mehr »global intervenieren« könnten.15
In der Krise 2007 ff. stand der Kapitalismus am Abgrund; die sozio-ökonomischen Krisenfolgen sind bis heute nicht überwunden. In dieser Lage verschärfte der neue US-Präsident Obama ab 2010 den Kurs gegen China – das mit dem Projekt der »Neuen Seidenstraße« (Belt and Road Initiative – BRI) und Aufrüstung reagierte. 2013 kündigte Xi Jinping an, die BRI werde die riesige eurasische Landmasse durch ein trikontinentales Netz von Eisenbahnen, Öl- und Gaspipelines sowie industrieller Infrastruktur (Kraftwerke, Häfen und Stromnetze) zum »größten Markt mit unvergleichlichem Potenzial« entwickeln. Neue Straßen- und Bahnverbindungen sollen einen deutlich schnelleren Transport zwischen Osten und Westen ermöglichen, aber auch von Afrika nach Europa und Asien. Diese Verkehrswege wären auch weniger als die bislang benutzten Wasserwege den Gefahren einer Blockade durch die USA und ihrer Verbündeten ausgesetzt. Zwischen 2013 und 2016 verdreifachten sich die chinesischen Direktinvestitionen im Ausland auf 216 Milliarden Dollar. 2017 wurde die BRI offiziell »eröffnet«. Laut einer Erhebung des American Enterprise Institute wurden von 2017 bis Ende 2021 Projekte im Wert von 838 Milliarden Dollar in Angriff genommen. Die von Xi angepeilte Billion ist nicht mehr fern. China könnte »gelingen, was alle hegemonialen Weltmächte seit 500 Jahren versucht haben: die Beherrschung der trikontinentalen Landmasse, auf der 70 Prozent der Weltbevölkerung leben«.16
Ebenfalls 2017 veröffentlichten die USA ihre Nationale Sicherheitsstrategie mit dem Titel Great Power Competition. Darin sehen sie sich in einem »gnadenlosen Konkurrenzkampf mit Russland und China«, die sie als »revisionistische Mächte«17 einstufen. Alle wirtschaftlichen und technologischen Potenziale müssten in diesen Kampf geworfen werden, um China auch im indo-pazifischen Raum Einhalt zu gebieten. Die KPCh versuche, ihr staatlich gelenktes Wirtschaftsmodell auszuweiten, die USA aus dem westlichen Pazifik zu verdrängen und die Region umzugestalten. Eine neue »Ära der Großmachtkonkurrenz« sei angebrochen, einschließlich eines systemischen Zusammenpralls »zwischen freien und repressiven Vorstellungen von Weltordnung«.182022 stuften dann Nato und Pentagon China als »strategische Bedrohung« ein, seine Integration in die internationale Ordnung sei gescheitert.
In das gleiche Horn stieß 2019 das Kieler Institut für Weltwirtschaft: China habe »aufgehört, sein Wirtschaftssystem dem westlichen Modell anzugleichen«. Damit ist gemeint, dass China zu mächtig geworden ist und auch durch Sanktions- und Zollpolitik nicht mehr auf dem Status der »Werkbank der Welt« gehalten werden kann; es will nicht länger Rohstoffe und Vorprodukte liefern, sondern diese in höherwertige Endprodukte einbauen. Um diese wirtschaftliche Entwicklung Chinas zu blockieren, ersetzt der Westen die für alle geltenden Regeln internationaler Wirtschaftsbeziehungen durch »Werte«. Auf einer Veranstaltung des Atlantic Council am 13. April 2022 deklamierte US-Finanzministerin Janet Yellen, es ginge nicht mehr um »fairen«, sondern um »sicheren« Handel (Friend Shoring). Das ist nur vordergründig eine Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine – in Wirklichkeit aber auf die gewachsene Macht der BRICS (Bündnis von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika). Der Ukrainekrieg hat dem Eisenbahn-Projekt auf der Neuen Seidenstraße jedenfalls einen schweren Schlag versetzt.
Ein Jahr Eskalation
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat es in der BRD keine solch rasante Militarisierung der Sprache, des Denkens und Handelns vor allem in den Medien und der Politik gegeben wie 2022.
Was mit 5000 Schutzhelmen begann, hat in kurzer Zeit ein enormes Ausmaß erreicht: Ende April die Entscheidung zur Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern, Anfang Mai die Lieferung von Panzerhaubitzen, Januar 2023 die Entscheidung zur Lieferung des Schützenpanzers Marder, dann der Kampfpanzer Leopard. Im ersten Kriegsjahr hat die BRD Waffen für drei Milliarden Euro geliefert. Sie ist beteiligt am Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland und spielt eine wichtige Rolle durch geheimdienstliche Unterstützung und die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Der Bundeswehrverbandsvorsitzende sagt, »dass wir in eine Art Kriegswirtschaft« übergehen müssten. Die FAZ spricht vom »Umbau zur Wehrwirtschaft«. Wer hätte sich das vor einem Jahr vorstellen können?
Im März 2022 torpedierte die Nato die ukrainisch-russischen Friedensgespräche in Istanbul, die eine neutrale Ukraine vorsahen. Einer der beiden Verhandlungsleiter, der ehemalige israelische Premierminister Bennett, sagte später, es hätte eine gute Chance auf einen Waffenstillstand gegeben, wenn der Westen ihn nicht verhindert hätte. Der andere Vermittler, der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, hatte bereits im April gegenüber CNN Türk erklärt: »Es gibt Länder in der Nato, die wollen, dass der Krieg weitergeht.« Auch Berater von Selenskyj hatten mitgeteilt, Boris Johnson habe bei seinem Besuch in Kiew gesagt, Putin und Russland sollten »unter Druck gesetzt werden, anstatt mit ihnen zu verhandeln«. Sollte die Ukraine ein Abkommen mit Russland abschließen, werde sich der »kollektive Westen« nicht daran beteiligen.19
Im Dezember 2022 gab das Pentagon sogar zu, der Ukraine grünes Licht für Drohnenangriffe auf Ziele in Russland Drohnen gegeben zu haben.20 Und die Washington Post deckte am 9. Februar 2023 auf, dass die USA in der Ukraine »Kontrollteams« einsetzen wollen, um die Truppenbewegungen zu überwachen. Zielinformationen für alle Angriffe mit modernen Waffensystemen stellten sie bereits zur Verfügung. Ein ukrainischer Militär sagte der Zeitung, wenn die USA hochmoderne ATACM-Raketensysteme lieferten, müsse niemand befürchten, dass sie missbräuchlich auf Russland abgefeuert würden. »Sie kontrollieren sowieso jeden Schuss. Wenn Sie also sagen: ›Wir haben Angst, dass man sie für andere Zwecke verwendet‹, dann sollte man bedenken, dass wir das gar nicht können, selbst wenn wir es wollten.«21
Die Nato stellt den Konflikt in der Öffentlichkeit zunehmend auch nicht mehr als begrenzten Versuch dar, einem Land bei der Abwehr einer Invasion zu helfen, sondern als existenziellen Kampf um das »Überleben des Westens«. Wenn Russland seine Existenz bedroht sieht, sind Vergeltungsschläge wegen der militärischen Hilfe für die Ukraine zu befürchten. Zuletzt Medwedew am 27. Februar 2023: »Wenn die Frage der Existenz Russlands selbst ernsthaft aufgeworfen wird, wird sie nicht an der ukrainischen Front entschieden.« Die Waffenlieferungen riskieren tatsächlich eine Eskalation bis zu einem Dritten Weltkrieg.
Atomwaffen – die härtere Nagelprobe
Aus diesem Grund erklärte Friedrich Merz Anfang Mai 2022, er habe keine Angst vor einem Atomkrieg. Monatelang verbreiteten die Medien die Message, wer Angst vor der Atombombe hat, mache »Kremlpropaganda« oder sei zumindest »Putin auf den Leim gegangen«. Am 16. Februar 2023 forderte ein Artikel in der FAZ, nun müsse Deutschland seine Außen- und Sicherheitspolitik neu ausrichten. Und zwar nicht nur mit Waffenlieferungen, mehr Geld für die Bundeswehr usw., sondern: »Die härtere Nagelprobe liegt [in] dem öffentlichen Bekenntnis zu nuklearer Abschreckung als einem unabdingbaren und legitimen Mittel«.22
Wie in den 50er und 60er Jahren werden schon wieder Tipps veröffentlicht, dass man der Druckwelle nach einer Atombombenexplosion am ehesten entkomme, wenn man sich von Fenstern, Türen und aus Korridoren entfernt. 2006 freigegebene Dokumente zeigen, dass der Einsatz von Atomwaffen 1954 in Korea und 1968 in Vietnam ernsthaft erwogen wurde. Erst im Oktober 1969 wurden solche Planungen eingestellt. Nixon war zu dem Schluss gekommen, dass die US-Öffentlichkeit für einen »nuklearen Entscheidungsschlag« gegen Nordvietnam mit wohl Hunderttausenden Toten nicht zu gewinnen war.
Das Pentagon hat die Lehren daraus gezogen und beschäftigt heute 27 000 Leute, die die Medien mit Informationen versorgen. Die Nato-Strategieschmiede Joint Air Power Competence Centre organisierte 2015 in Essen eine hochrangige Konferenz zur »Strategischen Kommunikation« gegen die Friedensbewegung, gesponsort von Rüstungsfirmen wie Airbus und Lockheed Martin. »Russlands Verhalten gegenüber der Ukraine unterstreicht die Dringlichkeit einer offensiven Öffentlichkeitsdiplomatie, mit der die Nato und die Nato-Staaten ihre öffentliche Diplomatie effektiv auch jenseits der Fähigkeiten einsetzen, die sie für ihren Afghanistan-Einsatz entwickelt haben.« Denn die wirkliche Grenze des Kriegs ist innenpolitisch, die größte Sorge die »Kriegsmüdigkeit«, der zentrale Feind die Friedensbewegung. Die Konferenz empfahl, einfache Geschichten mit klarem Gut-Böse-Muster zu verbreiten und sich nicht auf inhaltliche Argumente einzulassen, die widerlegt werden könnten wie damals die Ente mit den »Massenvernichtungswaffen des Irak«.23 Diese Lektion haben viele Medien verinnerlicht. Wer sich für Frieden ausspricht, wird umgehend aufgefordert, »das den vergewaltigten Frauen in der Ukraine zu sagen«.
Fußnoten:
[1] Lesenswert! Benedict Neff, »Wunsch und Wirklichkeit vermischen sich in der Berichterstattung«, in: NZZ 9.2.2023.
[2] Katja Maurer im Vorwort zu Raúl Sánchez Cedillo, Dieser Krieg endet nicht in der Ukraine, S. 9-10.
[3] Der jetzige CIA-Chef William Burns schreibt in seinem Buch The Back Channel 2019, Putin habe sich immer wieder die Videobilder von Gaddafis Ermordung angesehen. Das US-Magazin The Atlantic sah Anfang März 2022 eine »direkte Linie« von Gaddafis Ende zum Krieg in der Ukraine: »Als international Aussätziger ging es dem libyschen Herrscher am besten, erst als er sich dem Westen gegenüber öffnete, roch man in Washington Schwäche und forcierte seinen Sturz – ein Schicksal, das auch [Putin] erwarten könnte.«
Im Sicherheitsrat hatte Russland erstaunlicherweise auf ein Veto gegen die Errichtung einer Flugverbotszone über Libyen verzichtet – Interimspräsident Dmitri Medwedew hatte sich, wohl ohne Absprache mit seinem Premier Wladimir Putin, von dem damaligen US-Vize Joe Biden überreden lassen. So konnten französische Kampfflugzeuge ungehindert die Gaddafi-Truppen bombardieren. »Und anders als von Moskau erwartet, macht die NATO bei ihren Angriffen auch nicht vor der Hauptstadt halt, sondern erzwingt unter US-Führung – über das Mandat zur humanitären Intervention hinausgehend – den Sturz des libyschen Gewaltherrschers. Gaddafi muss fliehen. Am 20.10.2011 spüren ihn Milizionäre der neuen Regierung in der Nähe der Hafenstadt Sirte auf, versteckt in einem riesigen Abflussrohr. Sie prügeln ihn blutig und schieben ihm ihre Bajonette in den After, bis einer von ihnen den Geschändeten schließlich mit Schüssen erlöst.« (»Um Mitternacht bei dem Despoten« Die Zeit, 11.9.2022)
[4] Rede am 17.6.2022.
[5] Quelle: /www.govinfo.gov
[6] https://www.c-span.org/
[7] Verheiratet mit Robert Kagan, der unter anderem für US-Regierungen (unter beiden Parteien) arbeitete. Er zählt zu den bekanntesten Neokonservativen in den USA und gilt als Spezialist für internationale Politik, besonders Sicherheitspolitik, Terrorismus, den Balkan, das russisch-amerikanische Verhältnis und Themen rund um die NATO-
Erweiterung.
[9] Jürgen Wagner, »Der Ukraine-Krieg«, Endnote 15, IMI-Analyse 2023/08, imi-online.de, 22.2.2023.
[10] Vgl. Wolfgang Streeck: »Die Amerikaner meinen es bitterernst«, FR 24.2.2023.
[11] The conversation »Ukraine war follows decades of warnings that NATO expansion into Eastern Europe could provoke Russia«, 28.2.2022, auf Deutsch u.a. Branko Marcetic am 17.2.2023 auf Telepolis: »USA wussten, dass man Russlands rote Linien bei NATO-Expansion überschritt«.
[12] Ebenda.
[13] In Wirklichkeit war er bereits Wahlkampfberater von Johnson, später Sicherheitsberater von Jimmy Carter und hatte 1973 die Trilaterale Kommission gegründet.
[14] Birgit Mahnkopf: Der Kampf um Eurasien – Von der Globalisierung zurück zur Geopolitik, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Oktober 2022.
[15] Siehe Wildcat Sonderheft zum Irakkrieg. www.wildcat-www.de.
[16] Mahnkopf, a.a.O.
[17] Im Völkerrecht und in der internationalen Politik wird als Revisionismus das Bestreben bezeichnet, Grenzziehungen und andere in völkerrechtlichen Verträgen vereinbarte Regelungen zu ändern, sagt das Polit-Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung.
[18] Siehe den lesenwerten Artikel von Susan Watkins: »America vs China«, New Left Review 115, Jan/Feb 2019 – eigene Übersetzung.
[19] »Boris Johnson pressured Zelenskyy to ditch Peace Talks with Russa: Ukrainian Paper«, Common Dreams, 6.5.2022. www.commondreams.org
[20] »Pentagon gives Ukraine green light for drone strikes inside Russia«, The Times, 9.12.2022.
[21] »Ukraine’s rocket campaign reliant on U.S. precision targeting, officials say«, Washington Post, 9.1.2023.
[22] »Der nukleare Lackmustest der Zeitenwende«, FAZ 16.2.2023.
[23] Bernhard Trautvetter: »Strategische Kommunikation: Nuklearbellizisten gegen Friedensbewegung«, auf: Telepolis, 19.1.2023; dort auch weitere Quellen.