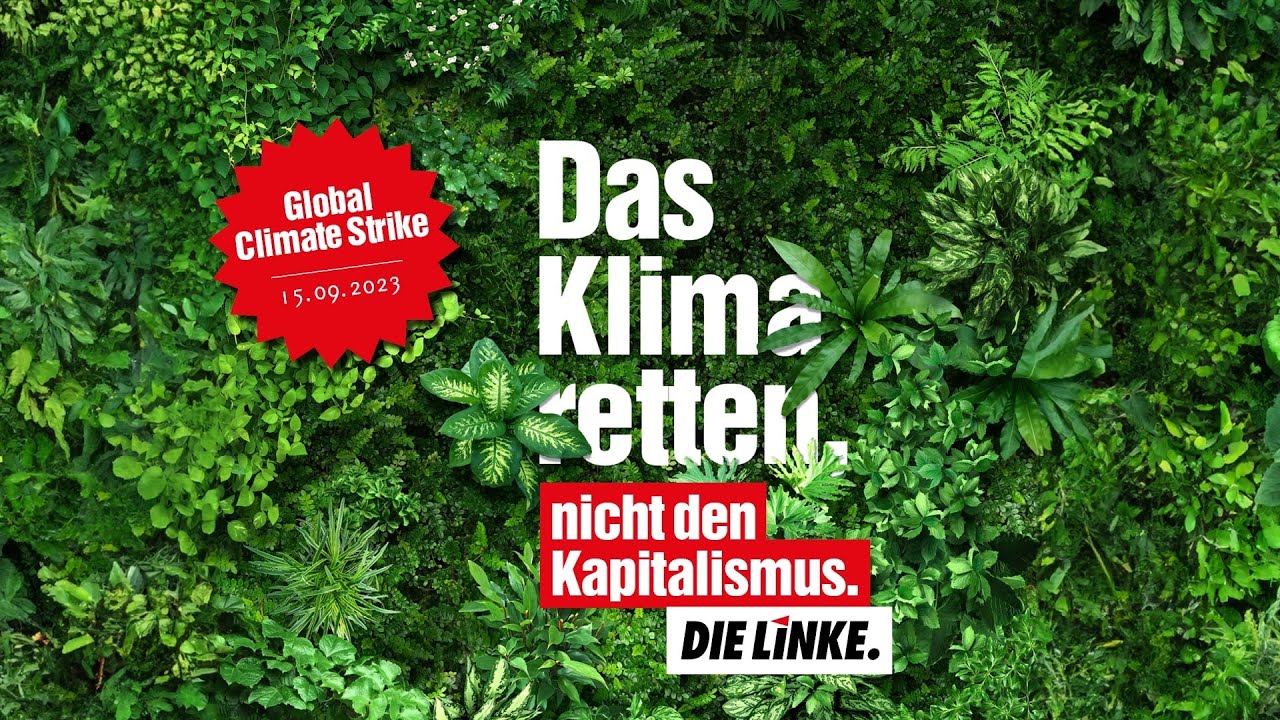Die „Fridays for Future“ rufen wie berichtet – ausnahmsweise – an einem Samstag, nämlich dem 20. September, zu einem deutschlandweiten Klimastreik auf. „Es ist hart, in diesen Zeiten, in dieser Welt“, wo „die Politik immer mehr Klimaschutzmaßnahmen abwürgt“, heißt es in der Ankündigung. Dabei ist man vor allem darum bemüht, den Schwung, den man 2019ff verspürte, wiederzufinden, und beklagt sich über die Untätigkeit der Politik. Dass die nicht einfach nichts fürs Klima tut, sondern mit Kriegen und Kriegsvorbereitungen tatkräftig für weitere unabsehbare Schäden sorgt, wird dabei vornehm verschwiegen. Rudolf Netzsch (Website: www.rudi-netzsch.de), der mit seiner Streitschrift zum Klimaprotest auch schon im Gewerkschaftsforum vorgestellt wurde, hat dazu ein Flugblatt veröffentlicht, das hier dokumentiert wird. Interessenten können sich den Text herunterladen und weitergeben. (Der Autor ist auch in einem Videopodcast zur Kritik der Klimabewegung bei 99zu1 aufgetreten: https://www.youtube.com/watch?v=yLw4j9RZcfs )
Von Rudolf Netzsch
Bild: DIE LINKE
„Es gibt viele Planeten, aber nur eine Wirtschaft!” witzelte einmal das Satiremagazin „Der Postillon“ – und traf damit ins Schwarze.
Denn was ist es, was die Politik daran hindert, sich an den Klimazielen zu orientieren? Genau: die Rücksicht auf die Wirtschaft. Das ist natürlich verrückt, denn wenn der Planet keine Lebensgrundlage für die menschliche Gesellschaft mehr bietet, dann ist auch Schluss mit der Wirtschaft. Diese Haltung ist allerdings nur logische Konsequenz daraus, dass sich die gesamte Gesellschaft in ihrem Handeln von der Wirtschaft mit ihren Konjunkturen bestimmen lässt. Dabei ist doch die Wirtschaft nichts Anderes als die Gesamtheit der Produktion und Verteilung von Gütern, so dass man erwarten würde, dass sie von den Menschen für ihre Zwecke eingerichtet und gestaltet wird.
Es ist eine merkwürdige Verkehrung – über die sich allerdings kaum mehr jemand wundert –, dass hier das Mittel zum Leben zu einem selbstständigen Subjekt wird, dem sich die ganze Gesellschaft unterordnet. „Die Wirtschaft“ wird zu einer eigenen, anonymen Wesenheit, die von den Wenigsten verstanden, von allen aber mit ihren konjunkturellen Höhen und Tiefen gleichsam als Schicksalsmacht hingenommen wird.
Die Wirtschaft wird zu einem Herrscher, der in geradezu diktatorischer Weise das gesamte gesellschaftliche Leben bestimmt. So sind ganze Heerscharen von Statistikern damit beschäftigt, die Fieberkurven der Wirtschaftskonjunkturen zu erstellen, und diese sind dann der Maßstab, der als unerbittliche Vorgabe für staatliches Handeln fungiert. Unsere Politiker, quer durch alle Parteien, kennen keine schlimmere Nachricht, als dass das Wirtschaftswachstum „einzubrechen“ drohe. Dem gegenzusteuern rechtfertigt für sie jede Schandtat. Das geht regelmäßig nicht nur auf Kosten von Umwelt und Klima, sondern auch der kleinen Leute. Denn die Reichen, also die, an die man denkt, wenn von „der Wirtschaft“ die Rede ist, dürfen nicht „belastet“ werden, um die Konjunktur nicht zu gefährden. So wird regelmäßig und ganz beiläufig dementiert, dass das Wirtschaftswachstum etwas wäre, was den Normalbürgern zugute kommt.
So wahnsinnig es ist: Statt den eigenen materiellen Lebensprozess bewusst zu gestalten, sind die menschlichen Gesellschaften – mittlerweile weltweit – so verfasst, dass sie von ihren eigenen Werken getrieben und gehetzt werden, auch wenn sie damit wissentlich ihrem Untergang entgegengehen.
Der Wirtschaft dienen heißt: ihr Wachstum fördern, auch wenn seit dem Club of Rome klar ist, dass die dafür akzeptablen Grenzen längst überschritten sind. Es gilt, gute Bedingungen für das Wachstum zu schaffen. Das führt zu begehrlichen Blicken auf das Ausland, denn dort befinden sich fürs Wachstum benötigte Absatzmärkte, Rohstoffquellen und Arbeitskräfte-Reserven. Dumm nur, dass die auswärtigen Herrscher ihrerseits ganz ähnliche Ziele verfolgen. So kommen sie sich regelmäßig in die Quere, machen sich gegenseitig ihre Geschäfte streitig. Bei den so entstehenden ständigen Querelen kann sich der am besten durchsetzen, der über die stärkste Wirtschaftsmacht verfügt. So wird das Wirtschaftswachstum zu einem Zwang, dem eine Tendenz zur Selbstverstärkung innewohnt; es heißt für alle Nationen: mitmachen oder verlieren.
Es bestehen Abhängigkeiten zwischen den Staaten, indem der eine hat, was der andere braucht, und die werden umgehend als Hebel für allerlei große und kleine Erpressungen ausgenutzt. Kurz: Es eröffnet sich das weite Feld der Diplomatie, die – wie schon Clausewitz wusste – ihre Fortsetzung im Krieg findet.
Freilich ist es nicht so, dass jeder Staat, der sich irgendwie von einem anderen wirtschaftlich benachteiligt fühlt, gleich zu den Waffen greift. Da befände sich längst jedes Land im Krieg mit jedem anderen. Aber als „letzte“ Option steht es dennoch immer im Raum. Erst einmal wird „friedlich-schiedlich“ um möglichst günstige Zugriffsbedingungen auf Reichtum und Ressourcen der anderen Nationen gefeilscht. Alle Staaten treten dabei als Betreuer ihres jeweiligen nationalen Kapitalstandorts auf und werden so zu Konkurrenten am kapitalistischen Weltmarkt, der inzwischen – nach dem Abdanken des sozialistischen Blocks – tatsächlich „global“ geworden ist. Der Ostblock versuchte, sich dem zu entziehen und wurde totgerüstet. Jetzt sind alle Staaten kapitalistisch verfasst und nehmen an der Weltmarktkonkurrenz so gut sie können teil, um nicht zum Verlierer zu werden, was in unserer „regelbasierten“ Weltordnung Konsequenzen hätte bis hin zum Absturz als „failed state“.
In dieser Konkurrenz wird vor allem die Stärke als Wirtschaftsstandort – aber auch als Militärmacht! – in Anschlag gebracht. Da spürt jeder Staat schnell die Begrenztheit seiner eigenen Möglichkeiten und versucht, sich mit anderen zu Bündnissen zusammen zu schließen. Das Ergebnis ist bekannt: Die ganze Welt teilt sich zunehmend in Blöcke auf, die gegeneinander „geostrategische“ Interessen verfolgen.
Das ist es, um was es in den heutigen militärischen Auseinandersetzungen geht: die Sicherung geopolitischer Einflusszonen. Da entscheidet sich u.a., welcher Staat bloß Rohstoffe liefern darf, und in wessen Machtbereich damit dann tatsächlich Reichtum produziert wird, der der weiteren Festigung der nationalen Stärke dient. Reine Eroberungskriege, wie zu Zeiten von Dschingis Khan und Alexander, wären heute dysfunktional, denn um Einfluss über fremdes Land zu gewinnen, ist es nicht mehr nötig, es dem eigenen Herrschaftsgebiet einzuverleiben. Um Bedrohungen gegen den jeweils als Feind definierten Staat aufzubauen, genügt es, in dessen Nachbarschaft Verbündete zu haben, auf deren Gebiet eigene Raketen und Militärbasen stationiert werden können. Wo Grenzverschiebungen angestrebt werden, bleiben diese als Frontbegradigungen oder Brückenköpfe dem geostrategischen Kalkül untergeordnet. Dennoch wird für Propagandazwecke gern die Idee von Eroberungskriegen beschworen, man denke nur an die Rede vom „imperialistischen Expansionsdrang“ Russlands. Da liegt eine Vorstellung von „Imperialismus“ zugrunde, die im Vergleich zu dem, was Imperialismus heute ist, fast schon ein wenig romantisch anmutet.
Und wenn man solche Reden für einen Augenblick gelten lassen wollte, so ergäbe sich nur Ungereimtes: Angenommen, es gäbe tatsächlich diese russischen „Expansionsgelüste“ – wie sollte daraus folgen, dass Deutschland zur stärksten konventionellen Militärmacht in Europa werden müsste, wo doch das geeinte Europa bereits jetzt über ein Vielfaches der militärischen Schlagkraft verfügt, die nötig wäre, um so etwas abzuwehren? Der Grund, warum Merz die Bundeswehr zur stärksten Armee Europas ausbauen will, ist ein anderer. Es geht um die geopolitische Stellung der Nation: nämlich um weltweiten Einfluss mittels der vereinten Stärke Europas – aber so, dass davon in erster Linie Deutschland profitiert, das deshalb seine Dominanz innerhalb der EU auch militärisch unterfüttern will.
Und was folgt daraus?
Wer sich politisch mit seiner Nation identifiziert, muss sich auch klar darüber sein, dass alle anderen Staaten der Welt dieselben einander wechselseitig in die Quere kommenden Prinzipien verfolgen, was dazu führt, dass das Klima in der Politik letztlich keine Rolle spielt, und dass er zudem auf den „Ernstfall“ gefasst sein muss, für den er bereits jetzt als Kanonenfutter oder ziviler Kollateralschaden verplant wird.
Man kann sich auch auf die Beobachterposition zurückziehen und fragen, was wohl eher kommen wird: der Klimakollaps oder der Dritte Weltkrieg? – Wollen wir darüber eine Wette abschließen? Der Gewinner darf den Preis im Grab entgegennehmen. Einen anderen Gedanken zu fassen, bedarf offenbar einer gewissen Anstrengung – so jedenfalls lautet eine Parole, die auf den Klima-Demos manchmal zu lesen ist:
„Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus“
Quelle: Gewerkschaftsforum Dortmund
https://gewerkschaftsforum.de/klimawandel-und-weltkriegslage/
Wir danken für das Publiktionsrecht.