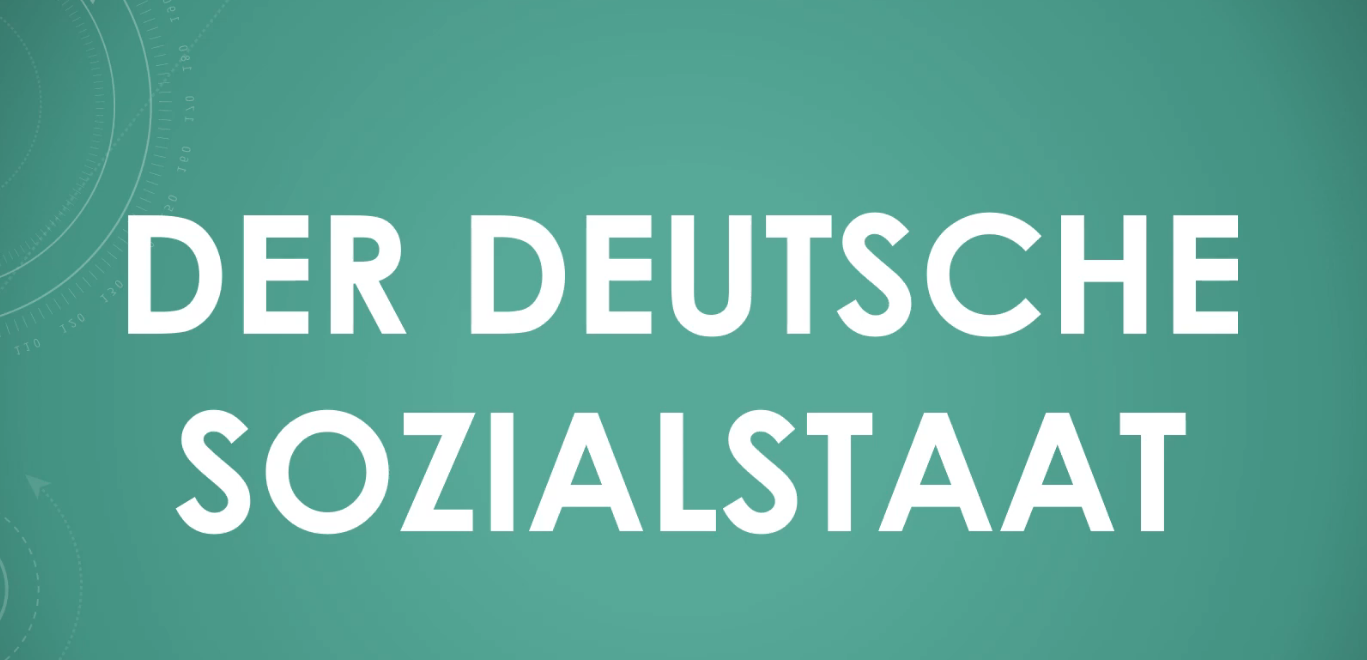Sozialstaat: Während der größten Aufrüstung der Nachkriegszeit steht er selbstverständlich wieder einmal zur Disposition. Was aber ist mit diesem Begriff gemeint?
Von Hans-Peter Waldrich
Bild: Screenshot You Tube Video
„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“, steht in Artikel 20 des Deutschen Grundgesetzes, der die grundlegenden Verfassungsprinzipien aufzählt. Das „Soziale“ gehört zum unveränderlichen Teil der Verfassung, ist also besonders wichtig.
Doch es gibt zwei völlig unterschiedliche Weisen, das Sozialstaatsprinzip zu verstehen. Weitgehend durchgesetzt hat sich jenes Verständnis, das den Interessen der Geldeliten entspricht bzw. den Milieus, die diesen Kreisen direkt zuarbeiten. Kanzler Merz gehört zu dieser Gruppe.
Almosenstaat oder soziale Demokratie?
„Sozial“ hat nach dieser Variante etwas mit dem Verteilen von Almosen zu tun. „Oben“ befinden sich jene, die anhand von Einkommens- und Vermögensdaten zeigen könne, wie fähig sie sind. Besteuerung „ihrer“ Leistungsergebnisse empfinden sie, wie der Soziologe Michael Hartmann nachweisen konnte, als zutiefst ungerecht. Dennoch sind sie bereit, kleinere Summen davon abzugeben. Nicht zuletzt, um soziale Unruhen zu vermeiden.
Almosen verteilen sie gern über private Stiftungen, ein speziell in den USA beliebtes Modell. Hier können sie selbst bestimmen, was mit den unbesteuerten Profiten geschehen soll. Von dieser Vorstellung ausgehend ist es nicht mehr weit zum Gedanken, den Steuer- und Verteilungsstaat überhaupt abzuschaffen. „Verteilen“ können die Hyperreichen auch selbst. Ich nehme an, Elon Musk denkt so ähnlich. Es gehört zur libertären Programmatik.
Völlig anders klingt jenes Verständnis des Sozialstaats, das in Deutschland einstmals maßgeblich von der SPD vertreten wurde. Dementsprechend war nach 1945 der erste Vorsitzende der West-Sozialdemokratie Kurt Schumacher der Auffassung, dass der Sozialstaat im Rahmen einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung unmöglich sei. In alter linker Tradition identifizierte er Sozialstaatlichkeit mit Demokratie. Der Monopolkapitalismus habe Hitler zur Macht gebracht, daher sei die konsequente Abschaffung der Klassenherrschaft gleichbedeutend mit dem Ausbau von Sozialstaatlichkeit als Demokratie.
Wer am Sozialstaat spart, spart an der Demokratie.
Diese Deutung entspricht den Interessen der vielen, die nicht über riesige Vermögen verfügen und sich damit einen privilegierten Zugang zu politischen Entscheidungen erkaufen können. „Sozial“ bedeutet hier nicht so etwas wie „mildtätig“, sondern schlicht „gesellschaftlich“. Der Begriff nimmt also Bezug auf eine Gesamtheit, auf die Gesamtheit der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Gemeint ist das demokratische Volk, von dem – ebenfalls nach Artikel 2O des Grundgesetzes – alle Staatsgewalt auszugehen hat. Soziales, also die Gesellschaft bezogenes Denken resultiert nicht aus der Besorgnis der hoch Privilegierten um den Verlust ihrer Privilegien, sondern ist eine Orientierung am Demokratiegedanken. Wer am Sozialstaat spart, spart an der Demokratie.
Genau an diesem Punkt befindet sich die traditionelle Scheidung linker und konservativer bzw. rechtet Positionen. Wer über das Soziale redet, spricht zugleich über die Demokratie. „Linke“, etwa im Sinne der alten Arbeiterbewegung oder der SPD, als sie noch im eigentlichen Sinn links war, bemängeln den undemokratischen Charakter des Kapitalismus. Wird der Kapitalismus demokratisiert, ist damit zugleich auch der Sozialstaat realisiert.
Das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl
Es geht also um das Staatsverständnis. Zweck des staatlichen Handelns, so die berühmte Formulierung des englischen Philosophen Jeremy Bentham, sei es, „das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl“ zu befördern. Das aber ist aber kaum das primäre Ziel der von den Riesenvermögen hin und her gestoßenen Regierungen. Wir sehen das etwa an der Unmöglichkeit, in Deutschland die einst ausgesetzte Vermögensteuer wiedereinzuführen. Aus der Sicht der Riesenvermögen ist die Bundesrepublik kein Staat, der sich am größtmöglichen Glück aller zu orientieren hat, sondern vor allem an der Vermögenspflege.
Dabei ist die Formulierung Benthams zugleich eine „linke“ Formulierung des Sozialstaatsprinzips. Ein solches Staatswesen orientiert sich an der großen Zahl, an der Bevölkerung insgesamt. Sofern in einer tatsächlichen sozialen Demokratie alle maßgeblich mitbestimmen, was geschehen soll, werden sie dafür sorgen, dass alle auch in sozialer Sicherheit leben. Jedenfalls werden sie kaum akzeptieren, dass sich die Früchte der Anstrengungen aller hochgradig in den Händen einer kleinen Minderheit ansammeln.
Demokratie oder Almosenstaat?
Der krasse Gegensatz dieser beiden Interpretationen von Sozialstaatlichkeit ist den meisten wohl kaum mehr präsent. Nach dem Zweiten Weltkrieg war eine soziale Demokratie im Sinne der allgemeinen Teilhabe Kernprogramm der SPD und fand sich auch bei Teilen der CDU/CSU. Die Tradition des christlichen Sozialismus verstand Solidarität als ein Gebot der christlichen Nächstenliebe. Alle haben ein Recht auf Teilhabe in der Mitbestimmung sowie im Hinblick auf die Ergebnisse der Ökonomie.1
Die gegenwärtige Debatte kennt nur noch den ausgedünnten Sozialstaatsbegriff. Das „Soziale“ bezieht sich nach dieser Lesart auf moderne Formen der Armenspeisung. Hier kommt freiwillige Wohltätigkeit zum Einsatz. Gespendet wird, was noch übrig ist. Und hier kann natürlich gespart werden, denn die entsprechenden Mittel gehören substanziell nicht zum eigentlichen Budget.
Die Frage, in welchem Umfang Almosen verteilt werden sollen – „Wohltaten“ in der Sprache des Neoliberalismus – hat mit der Demokratiefrage nichts zu tun.
Doch manchmal (bei Herrn Klingbeil zurzeit?) blitzt eine Erinnerung daran auf, was einmal zum eigenen Parteiprogramm gehörte. Aber die Interessen der dominierenden Kapitaleliten, bestens vertreten durch den Bundeskanzler, werden sich als gewichtiger erweisen. Schließlich könnte es einmal nötig sein, das Privilegiensystem mit Panzern und Raketen zu verteidigen, wenn nichts mehr übrig ist für die Armenspeisung.
1Hans-Peter Waldrich: Demokratie als Sozialismus. Westdeutschland und die Ideen der ersten Stunde, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Mai 2019.

Hans-Peter Waldrich hat sein Geld vor allem im Bildungswesen und -unwesen verdient, an Schulen und Hochschulen und unter anderem beim Bundesamt für den Zivildienst. Während der 1980 Jahre engagierte er sich maßgeblich in der Friedensbewegung. Seit seiner Jugend schrieb er für eine Vielzahl von Zeitungen und Zeitschriften, etwa den Freitag, und veröffentlichte mehrere Bücher, vor allem zu politischen, pädagogischen und philosophischen Fragen. Er hält sich zugute, dass er sich niemals genötigt sah zu publizieren, um davon leben zu müssen und dass er stets nur auf eines Rücksicht zu nehmen hatte: seine eigenen Überzeugungen.
Mehr Beiträge von Hans-Peter Waldrich →
Erstveröffentlicht im Overton Magazin v. 4.9. 2025
https://overton-magazin.de/kommentar/gesellschaft-kommentar/kanonen-statt-butter-an-was-soll-denn-nun-gespart-werden/
Wir danken für das Publikationsrecht.